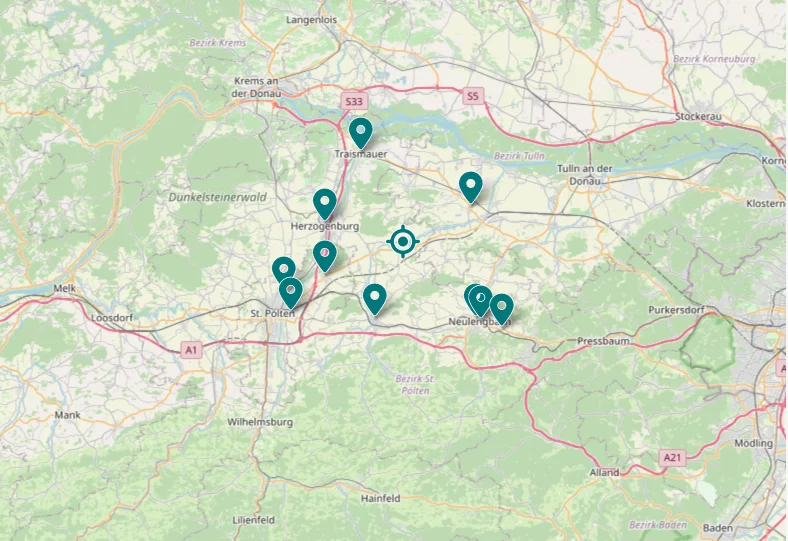Durch eine aktive Teilnahme am Leben kann der gefürchteten Geisteskrankheit Alzheimer bis zu einem gewissen Grad vorgebeugt werden. Validation, eine spezielle Kommunikations- und Umgangsform mit Alzheimer-Patient:innen, ist eine weitere Möglichkeit, in frühen Phasen das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die Lebensqualität der Betroffenen zu erhöhen. Einen Alzheimer-Test gibt es nicht, der Mini-Mental-Status- und Uhrentest können aber aussagen, ob eine Demenz wahrscheinlich ist.
Zusammenfassung
- Alzheimer ist die häufigste Demenzerkrankung und betrifft über 100.000 Menschen in Österreich.
- Im Verlauf der Krankheit verlieren Betroffene schrittweise ihr Kurzzeitgedächtnis.
- Die Ursachen von Alzheimer liegen in der Bildung von schädlichen Proteinen und Plaques im Gehirn, die Nervenzellen angreifen.
- Alzheimer tritt verstärkt im Alter auf und Frauen erkranken doppelt so häufig wie Männer.
- Die Validation ist eine spezielle Kommunikationsform für Alzheimerkranke und Angehörige und hilft das Verhalten der Patient:in zu akzeptieren und Ängste zu lindern.
An Morbus Alzheimer leiden heute mehr als 100.000 Österreicher:innen, im Jahr 2050 sollen es weit mehr als doppelt bis knapp dreimal so viele sein, weltweit rechnet man dann mit mehr als 120 Millionen Alzheimer-Patient:innen.
Die große Zunahme hat auch mit der immer älter werdenden Gesellschaft zu tun: Von den 60-Jährigen leidet jede hundertste Person an Alzheimer, von den 90-Jährigen bereits jede dritte Person. Neben dem Alter ist auch das Geschlecht ein Risikofaktor: Frauen erkranken doppelt so häufig.
Zu den Ursachen gehören Proteine und Plaques, die sich im Gehirn bilden und dort die Nervenzellen schädigen, Nervenzellen sterben nach und nach ab. Wie diese Proteine und Plaques entstehen, ist noch nicht restlos geklärt. Zu den Veränderungen im Gehirn kommt es übrigens bereits rund 20 Jahre vor dem Auftreten erster Anzeichen.
Video: Leben mit Demenz: Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige
Mag. Verena Bramböck, BA (Leiterin der Koordinationsstelle Demenz, Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol) erklärt, wo Betroffene von Demenz und deren Angehörige Unterstützung bekommen. (Webinar, 04.08.2021)
Alzheimer schreitet langsam fort – man spricht von einer leichten, mittelschweren und schweren Form. Der Betroffene verliert nach und nach Kurzzeitgedächtnis, Orientierung, Sprache, Erinnerung.
| Leicht | Am Anfang werden die Sätze etwas kürzer, fällt einem das eine oder andere Wort nicht ein, ist es "nur" der Schlüssel, den man nicht mehr findet. Die Fähigkeit, sich an weit zurückliegende Dinge zu erinnern, ist oft noch nicht beeinträchtigt. |
|---|---|
| Mittelschwer | Bei der mittelschweren Form werden die Betroffenen unruhig, finden sich in ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr oder nur noch schwer zurecht, alltägliche Tätigkeiten – wie Waschen oder Essen – fallen schon schwer. |
| Schwere Form | Zum Schluss weiß der Betroffen:e nicht mehr, welcher Tag heute ist, die Orientierung fehlt völlig, der Betroffen:e kennt die eigene Tochter, die Partner:in nicht mehr. Auch die Persönlichkeit geht allmählich verloren, das Sozialverhalten ändert sich – bis nichts mehr von dem Menschen bleibt, der er einmal war. |
Mehr zum Thema: Alzheimer » 7 Risikofaktoren
Laut amerikanischem National Institute on Aging können folgende 7 Warnzeichen auf eine Alzheimer-Erkrankung hinweisen:
-
Der Erkrankte wiederholt immer wieder die gleiche Frage.
-
Der Erkrankte erzählt immer wieder die gleiche kurze Geschichte.
-
Der Erkrankte weiß nicht mehr, wie bestimmte alltägliche Verrichtungen wie Kochen, Kartenspiel, Handhabung der TV-Fernbedienung funktionieren.
-
Der Erkrankte hat den sicheren Umgang mit Geld, Überweisungen, Rechnungen und Ähnlichem verloren.
-
Der Erkrankte findet viele Gegenstände nicht mehr oder er legt sie an ungewöhnliche Plätze (unabsichtliches Verstecken) und verdächtigt andere Personen, den vermissten Gegenstand weggenommen zu haben.
-
Der Erkrankte vernachlässigt anhaltend sein Äußeres, bestreitet dies aber.
-
Der Erkrankte antwortet auf Fragen, indem er die ihm gestellte Frage wiederholt.
Mehr zum Thema: Alzheimer » "Nur vergesslich" oder krank?
Für die Diagnose ist die Fachärzt:in für Neurologie oder Psychiatrie zuständig. Es wird unter anderem ein Uhrentest und ein Gedächtnistest (Alzheimer-Test, Mini-Mental-Status-Examination = MMSE) vorgenommen, der 9 Aufgabenbereiche umfasst.
Überprüft werden:
- Merk- und Erinnerungsfähigkeit
- zeitliche und räumliche Orientierungsfähigkeit
- Sprechen und Sprachverständnis
- Lesen
- Schreiben
- Zeichnen
- Rechnen
Für jede richtig erfüllte Aufgabe gibt es einen Punkt von insgesamt 30. 20 bis 26 Punkte bedeuten leichte Demenz, 11 bis 19 mittelschwere, 0 bis 10 schwere Demenz und 27 bis 30 ist normal. Dieser Test alleine ist aber zu wenig, um eine Demenz zu beweisen. Zusätzlich helfen Blutuntersuchung, eine spezielle Form der Magnetresonanztomographie und eine Untersuchung des Liquor (Hirnflüssigkeit) auf alzheimertypische Veränderungen bei der Diagnose, die so mit hoher Zuverlässigkeit gestellt werden kann. 100-prozentig aber kann die Krankheit erst nach dem Tod durch eine histologische Untersuchung des Gehirns gesichert werden.
Verwechslungsgefahr mit Altersdepression
Allerdings: Nicht jedes Vergessen muss gleich Alzheimer sein. Mitunter steckt eine Depression dahinter. Ein wichtiger Unterschied zwischen Depression und Alzheimer ist die Orientierungsfähigkeit. Depressive können in der Regel Datum, Uhrzeit und Ort richtig angeben, Alzheimer-Patient:innen sind dazu häufig nicht mehr in der Lage.
Die Österreichische Ärztekammer hat im Rahmen ihrer Kampagne "Leben mit Vergessen" die Checkliste "Vergesslich oder dement" aufgelegt, mittels welcher Angehörige herausfinden können, ob die betroffene Person gefährdet ist.
- Medikamentös (Tabletten, Pflaster): Medikamentös kann man die Krankheit im besten Fall ein wenig hinauszögern, aber nicht stoppen und schon gar nicht heilen. Expert:innen sind sich sicher: Arzneien sind umso effektiver, je früher sie eingesetzt werden.
- Alzheimer-Impfung: Eine Alzheimer-Impfung ist noch in Entwicklung. Komplementär dazu können Ginkgo biloba und Vitamin E helfen.
- Förderung des sozialen Umfelds: Angehörige können mit aktivierender Pflege noch vorhandene Fähigkeiten und damit Selbstständigkeit und ein positives Selbstwertgefühl fördern. Dabei unterstützen auch Gedächtnistraining sowie Physio- und Bewegungstherapie, Musik- und Psychotherapie, kognitives Training. Auch der Besuch einer Memory-Klinik (Liste unter anderem bei der Initiative Leben mit Vergessen) ist sehr empfehlenswert.
- Validation: Sehr hilfreich für Angehörige und Alzheimerkrankte ist auch die Validation, eine einfühlsame, spezielle Kommunikations- und Umgangsform, die man in Kursen erlernen kann (unter anderem beim Roten Kreuz). Validation basiert auf einer wertschätzenden Geisteshaltung der Alzheimer-Patient:in gegenüber: Die Betreuer:in versetzt sich in die Welt der kranken Person, verurteilt nicht, bessert nicht aus, sondern akzeptiert das Verhalten der Patient:in als zugehörig zu ihrer Welt. Naomi Feil, die Begründerin der Validation, betont immer wieder, dass hinter jedem Verhalten eines desorientierten Menschen, mag es noch so verrückt oder absurd wirken, ein Grund steckt. Validation ist auch imstande, Ängste und Unruhegefühle der Patient:in zu lindern.
Video: Gemeinsamer Urlaub. Trotz Demenz! Aber wie?
Trotz Demenzerkrankung gemeinsam auf Urlaub fahren? Wie ein solcher Urlaub sowohl für Angehörige als auch für Betroffene eine Entlastung ohne Trennung werden kann, erklärt Mag. Ursula Kienberger von der MAS Alzheimerhilfe. (Webinar, 08.05.2023)
- Validation: Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen, N. Feil, V. de Klerk-Rubin, Ernst Reinhardt Verlag, 10. Auflage, München, 2013
- Österreichische Alzheimergesellschaft, Alzheimer Selbsthilfe, Demenz-Hilfe