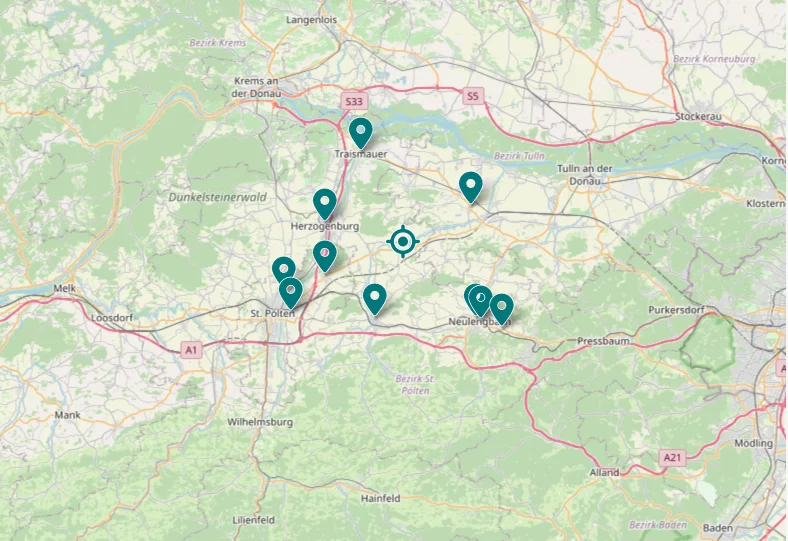Ein epileptischer Anfall dauert in der Regel wenige Sekunden bis Minuten, dabei kann es je nach Anfallsursprung zu geistiger Abwesenheit des Betroffenen, abnormalen psychischen oder sensorischen Empfindungen (Auren) oder auch den typischen Krämpfen kommen. Die Krämpfe können generalisiert (den ganzen Körper betreffend) oder fokal (einzelne Extremitäten, meist eine Körperhälfte betreffend) auftreten. Etwa 5 bis 10 von 1.000 Personen erkranken im Laufe ihres Lebens an Epilepsie. Eine medikamentöse Therapie kann bei etwa zwei Drittel aller Betroffenen das Auftreten von Anfällen verhindern.
Zusammenfassung
- Epilepsie ist eine Gehirnerkrankung, die zu wiederkehrenden Anfällen führt, die unterschiedliche Formen annehmen können.
- Anfälle können generalisiert (das ganze Hirn betreffend) oder fokal (eine bestimmte Hirnregionen betreffend) sein.
- Epilepsie kann genetisch bedingt sein oder durch erworbene Hirnschädigungen ausgelöst werden.
- Die Diagnose erfolgt in der Regel durch Anamnese, EEG und MRT.
- Eine Behandlung umfasst die Verwendung von Medikamenten, chirurgische Eingriffe bei therapieresistenten Fällen und selten die Vagus-Nerv-Stimulation.
FAQ (Häufige Fragen)
Was ist der Auslöser von Epilepsie?
Epilepsie kann viele Ursachen haben. Einerseits geht die Medizin davon aus, dass die Erkrankung eine gewisse genetische Komponente hat. Andererseits können Hirnschädigungen (erworbene oder angeborene) die Erkrankung auslösen.
Was sind Anzeichen einer Epilepsie?
Eine extreme Entladung von Neuronen, zum Beispiel an der Hirnrinde, führt zu unterschiedlichen vorübergehenden Phänomenen, wie etwa Zuckungen sowie gestörten sensorischen oder psychischen Empfindungen. Am dramatischsten sind Anfälle, die mit Krämpfen und Sturz einhergehen, die Anfälle können jedoch auch so verlaufen, dass sie von der Umgebung kaum wahrgenommen werden.
Ist Epilepsie heilbar?
Bei circa 2/3 der Patient:innen kann nach dem Einsetzen einer geeigneten medikamentösen Therapie Anfallsfreiheit erzielt werden. Etwa ein Drittel der Patient:innen ist pharmakoresistent, das heißt, sie sprechen auf Medikamente nicht oder nicht ausreichend an und Anfälle treten immer wieder auf. Bei pharmakoresistenten Betroffenen kann, je nachdem von welcher Gehirnregion der Anfall ausgeht, auch ein Epilepsie-chirurgischer Eingriff erfolgen.
Epilepsie ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der das Gehirn vorübergehend nicht regulär funktionsfähig ist. Grund für diese Fehlfunktion ist eine extreme Entladung von Neuronen, meist an der Hirnrinde, die zu unterschiedlichen vorübergehenden Phänomenen führt, wie etwa Zuckungen sowie gestörten sensorischen oder psychischen Empfindungen. Zu diesen Entladungen kommt es aufgrund einer plötzlichen Aktivitätssteigerung von Nervenzellen.
Dramatisch und den meisten Menschen bekannt sind Anfälle, die mit Krämpfen und Sturz einhergehen, Anfälle können jedoch auch so verlaufen, dass sie von der Umgebung kaum wahrgenommen werden.
Etwa zehn von hundert Personen haben im Laufe ihres Lebens einen epileptischen Anfall. Erleidet man einen Anfall, heißt das jedoch noch nicht automatisch, dass es zu weiteren kommt.
Nur, wenn epileptische Anfälle immer wieder spontan auftreten, spricht man von einer Epilepsie. Ungefähr fünf bis zehn von 1.000 Personen erkranken im Laufe Ihres Lebens daran. Epilepsie kann generell in jedem Alter auftreten. Vor allem aber bei Kleinkindern und Senior:innen kommt es statistisch gesehen am häufigsten zu Neuerkrankungen.
Video: Epilepsie: Gewitter im Kopf
Dr. Gertraud Puttinger klärt über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Epilepsie auf. (Webinar, 15.12.2023)
Grundsätzlich unterscheidet man bei Epilepsie zwei Anfallsformen:
- Fokale Anfälle
- Generalisierte Anfälle
1. Fokale Anfälle
Fokale Anfälle betreffen einen bestimmten Bereich des Gehirns. Auftretende Symptome sind davon abhängig, für welche Funktion der Gehirnbereich zuständig ist, wie z.B. eine Veränderung des Sehens (visueller Anfall), ein Zucken des Arms (motorischer Anfall) oder eine Gefühlsstörung (sensorischer Anfall). Manche fokalen Anfälle führen auch zu Bewusstseinsstörungen. Fokale Anfälle können sich im Verlauf auch auf das ganze Gehirn ausbreiten, man nennt dies sekundäre Generalisation.
Auren als mildeste Anfallsart oder Epilepsie-Vorbote
Auren dauern meist nur wenige Sekunden und können als einziges Symptom eines fokalen Anfalls auftreten oder auch andere Formen einleiten. Nur der Betroffen:e erlebt eine Aura. Diese Aura kann sich unterschiedlich äußern: Lichterscheinungen, Geruchshalluzinationen, ein Kribbeln in Armen oder Beinen, ein charakteristisches aufsteigendes Gefühl aus der Magengrube (epigastrische Aura) oder Déjà-vu-Erlebnisse sind nur einige dieser Vorgefühle.
2. Generalisierte Anfälle
Generalisierte Anfälle erfassen das gesamte Gehirn und führen meist zu Bewusstlosigkeit und manchmal zu Krämpfen am ganzen Körper. Es gibt verschiedene Formen von generalisierten Anfällen:
| Absencen | Absencen sind generalisierte Anfälle, in denen das Bewusstsein für einige Sekunden aussetzt, Betroffene setzen aber meist danach ohne Unterbrechung ihre Tätigkeiten fort. Mitunter können Absencen von Symptomen wie (Gesichts-)Muskelzucken, Zucken der Augenlider u.ä. Symptomen begleitet sein. Diese Epilepsie-Art tritt oft im Kindesalter auf, Betroffene entwickeln im Krankheitsverlauf oft auch andere Anfallstypen. Oft finden sich genetische Ursachen. |
|---|---|
| Myoklonischer Anfall | Ein myoklonischer Anfall macht sich durch nicht-rhythmische ruckartige Muskelzuckungen, die so ablaufen, als wären sie von einem elektrischen Schlag verursacht worden, bemerkbar. Dieser Anfallstyp kann bei kleinen Kindern im Rahmen oft schwerer Erkrankungen, wie dem Lennox-Gastaut-Syndrom auftreten. In der Adoleszenz spricht das Neuauftreten myoklonischer Anfälle beim Aufwachen für eine genetisch determinierte Epilepsieform, die oft auch zu schwereren Anfällen führt, aber gut behandelbar ist. Myoklonische Anfälle sollen nicht mit dem harmlosen Muskelzucken beim Einschlafen ("Einschlafmyoklonus"), das fast jeder von sich kennt, verwechselt werden. |
| Tonischer Anfall | Tonische Anfälle (auch Versiv- oder Haltungsanfälle genannt) treten oft auch im Schlaf auf: der Körper wird zur Seite gedreht, die Augen verdrehen sich zu einer Seite. Manche Patient:innen stürzen im Zuge eines solchen Anfalls. Der Anfall kann aber auch so kurz sein, dass er einem Erschrecken ähnelt, meist verlieren die Betroffenen dann auch nicht offensichtlich das Bewusstsein. |
| Atonischer Anfall | Atonische Anfälle führen zu einem plötzlichen Verlust der Muskelspannung. Dabei kann beispielsweise das Kinn auf die Brust fallen oder die Beine des Betroffenen knicken ein. Auch ist es möglich, dass man kurz das Bewusstsein verliert und stürzt. |
| Klonischer Anfall | Ein klonischer Anfall äußert sich durch Muskelzucken an verschiedenen Muskelgruppen. Bei einem klonischen Anfall sind die Zuckungen – im Gegensatz zum myoklonischen Anfall – rhythmisch und dauern länger an. |
| Bilateraler oder generalisierter tonisch-klonischer Anfall ("Großer Anfall", "Grand-Mal") |
Darunter wird eine dramatische Ausprägung eines epileptischen Anfalls bezeichnet. Manchmal kommt es zuvor zu anderen Anfallssymptomen z.B. in Form einer Aura. Der Betroffene beginnt zu stöhnen, meist stürzt er und die Muskeln erstarren tonisch. Verdrehte Augen und ein verzerrtes Gesicht sowie starker Speichelfluss sind weitere Begleitsymptome. Die Muskeln des ganzen Körpers beginnen zu zucken (die klonische Phase) – der Anfall kann bis zu 2 Minuten dauern. Dabei besteht die Gefahr, dass sich der Betroffen:e auf die Zunge oder in die Wange beißt. Es kann zu Harn- oder Stuhlverlust kommen. Erst nach dem Erschlaffen der Muskeln erlangt die Patient:in üblicherweise wieder sein Bewusstsein, bleibt aber im Zustand der momentanen Verwirrung und Orientierungslosigkeit (Dies wird auch "postiktale Dämmerzustand" genannt). Im Anschluss an den Anfall klagen Betroffen:e oft über Übelkeit, Kopfschmerzen oder Muskelkater. Dieser Anfallstyp ist insgesamt sehr häufig und kommt sowohl bei fokalen Epilepsien (im Sinne einer sogenannten sekundären Generalisierung) als auch bei generalisierten Epilepsien vor. Im zweiten Fall findet sich oft auch eine genetische Vorbelastung. |
Man unterscheidet drei Situationen bzgl. der Ursache einer Epilepsie:
- Genetische Faktoren (Gendefekt, genetische Komponente, die den Ausbruch der Erkrankung begünstigen kann): Epilepsie tritt in manchen Familien gehäuft, über mehrere Generationen, auf.
- Strukturell bedingte Epilepsie, die nach Schlaganfällen, Schädelhirntrauma, Infektionen, Gehirntumoren, Hirnhaut- oder Gehirnentzündungen, Gefäßmissbildungen, Stoffwechselstörungen u.v.m. entstehen kann.
- Epilepsien unbekannter Ursache: In etwa 20 % der Fälle kann trotz diagnostischer Bemühungen keine definitive Ursache festgestellt werden.
Bestimmte Reize können bei Menschen mit Epilepsie einen Anfall auslösen. Häufige Risikofaktoren, die bei manchen Patient:innen Anfälle begünstigen können, sind:
Anamnese
Der erste Schritt in der Diagnose ist eine umfassende Anamnese. Wichtig dabei ist, dass der Betroffen:e oder eine Augenzeug:in genau beschreibt, wann, unter welchen Umständen und wie der Anfall verlaufen ist, z.B.
- mit Aura
- mit Verlust des Bewusstseins
- mit motorischen Einschränkungen
- Sturz
- und wie lange der Anfall gedauert hat.
Auch nachfolgende Symptome, wie Kopfschmerzen, Sprachstörungen, Fieber, Schlaflosigkeit etc. erleichtern der Ärzt:in eine exakte Diagnose. Weiters ist es möglicherweise ein entscheidender Hinweis, wenn Infektionen vorliegen, der Betroffen:e bereits ein Schädel-Hirntrauma erlitten hat oder an einer anderen Erkrankung (Gehirntumor) leidet. Auch die Familiengeschichte ist im Hinblick auf die erbliche Vorbelastung wichtig. Da sich viele Betroffene oft nicht an den Anfall selbst erinnern können, ist auch eine sogenannte Fremdanamnese von Bedeutung, also eine Beschreibung des Anfalls durch Personen, die ihn miterlebt haben.
Danach folgt eine körperliche und neurologische Untersuchung:
Bei vielen Patient:innen ergibt die körperliche Untersuchung aber zwischen den Anfällen einen völlig unauffälligen Befund. Die wichtigsten Zusatzuntersuchungen in der Abklärung von Epilepsien sind das EEG und die MRT
Elektroenzephalographie (EEG)
Mit einem EEG können die Hirnströme gemessen werden. Die Untersuchung kann bei vielen Patient:innen, die für die Erkrankung typischen Entladungen der Neuronen an der Hirnrinde sichtbar machen. So deuten bestimmte Muster auf eine erhöhte Anfallsneigung hin. Die Untersuchung ist völlig ungefährlich und hat keine Nebenwirkungen. Oft findet sich jedoch auch bei Betroffenen mit sicherer Epilepsie ein unauffälliger EEG-Befund. Für die Diagnosestellung ist daher ein EEG allein oft nicht ausreichend.
Ein EEG sollte möglichst zeitnah nach dem Ereignis durchgeführt werden. Sollte im Wach-EEG kein Nachweis möglich sein, sollte eine Untersuchung im Schlaf oder nach Schlafentzug erfolgen, da die Entladungen in dieser Phase am besten zu beobachten sind.
Magnetresonanz-Tomographie (MRT)
Um strukturelle Veränderungen im Gehirn sichtbar zu machen, die möglicherweise Ursachen für eine Epilepsie sind, ist MRT hilfreich. Dadurch können z.B. Tumoren, Gefäßmissbildungen oder andere Veränderungen diagnostiziert werden.
In vielen Fällen kann mit der Kombination von EEG und MRT eine verlässliche Diagnose gestellt werden, es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass keine Ursache gefunden werden kann.
Mehr zum Thema: Tourette-Syndrom » Unkontrollierte Muskelzuckungen und Lautäußerungen...
Ziel der Therapie ist Anfallsfreiheit. Nur wenn dies gelingt, ist die Lebensqualität des Betroffenen nicht wesentlich beeinträchtigt. Dies gilt nicht nur für die sogenannten großen Anfälle. Auch leichte Anfallsformen sollen im Rahmen einer sinnvollen Therapie nicht toleriert und müssen behandelt werden, was oft auch erfolgreich gelingt.
Medikamente
In den meisten Fällen werden zur Behandlung Medikamente eingesetzt. Diese werden üblicherweise Antiepileptika genannt. Sie wirken jedoch nicht "anitepileptisch", das heißt, sie heilen nicht die Neigung, einen Anfall zu bekommen. Sie blockieren vielmehr das Auftreten von Anfällen, indem sie die diesbezügliche Schwelle erhöhen. Richtiger spricht man daher heute von anfallssupprimierenden (also anfallsunterdrückenden) Medikamenten. Es stehen zahlreiche unterschiedliche Medikamente aus verschiedenen Wirkstoffgruppen zur Verfügung. Einige, gerade auch der neueren Medikamente, sind im Allgemeinen ausgezeichnet verträglich.
Nach einer genauen Diagnose sollte eine Monotherapie mit einem einzigen Medikament eingeleitet werden. Um einen optimalen Erfolg zu erzielen, müssen manchmal verschiedene Arzneimittel ausprobiert werden. Bei der Hälfte der Betroffenen wird schon mit dem ersten versuchten Medikament Anfallsfreiheit erzielt. Nur, wenn auch nach mehreren Monotherapien keine ausreichende Anfallskontrolle erzielt werden kann, kommt auch eine Kombinationstherapie mehrerer verschiedener Medikamente zum Einsatz. Insgesamt kann bei circa 2/3 der Patient:innen mit dieser Vorgangsweise Anfallsfreiheit erzielt werden.
Pharmakoresistenz
Das bedeutet jedoch auch, dass trotz mehrerer Behandlungsversuche in korrekter Vorgangsweise schließlich etwa ein Drittel der Patient:innen pharmakoresistent ist, das heißt, sie sprechen auf Medikamente nicht oder nicht ausreichend an und Anfälle treten immer wieder auf.
Epilepsie-Chirurgie
Bei pharmakoresistenten Betroffenen kann, je nachdem von welcher Gehirnregion der Anfall ausgeht, auch ein Epilepsie-chirurgischer Eingriff erfolgen, bei dem das Hirngewebe entfernt wird, von dem die Anfälle ausgehen. Dies verlangt eine sehr ausführliche Diagnostik. Unter anderem ist es dazu notwendig, Anfälle und das sie begleitende EEG mit Hilfe eines sogenannten Video-EEG Monitorings im Rahmen eines Spitalsaufenthaltes aufzuzeichnen. Viele über Jahre pharmakoresistente Patient:innen können durch einen epilepsiechirurgischen Eingriff Anfallsfreiheit erzielen.
Die Vagus-Nerv-Stimulation (VNS)
Diese Methode ist eine Option für Betroffene, die nicht für eine Operation infrage kommen bzw. bei denen die OP nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Bei dieser Methode wird der Nervus vagus, einer von zwölf Hirnnerven, stimuliert.
Ziel der Therapie ist Anfallsfreiheit. Dies gilt nicht nur für die sogenannten großen Anfälle. Auch leichte Anfallsformen sollen im Rahmen einer sinnvollen Therapie nicht toleriert werden und müssen behandelt werden.
Um Epilepsie im Alltag besser bewältigen zu können, helfen ein fundiertes Wissen und ein weitgehend selbstsicherer Umgang. Es ist gut, wenn man die Umwelt mit Informationen über die Erkrankung versorgen kann, damit sie das nötige Verständnis für die Erkrankung entwickeln. Günstig ist es, sich bei Vertrauten zu informieren, wie das eigene Verhalten im Akutfall ist, sodass man gemeinsam einen Plan entwickeln kann, was im Fall eines Anfalls zu tun ist. Wenn Angehörige, Partner:innen und Freund:innen gut informiert sind, ist es für diese auch leichter, bereits verdächtige Vorzeichen zu erkennen.
Erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall
- Den Betroffenen sicher hinlegen, sodass er sich nicht verletzten kann.
- Vorsicht vor Verletzungen am Kopf! Schützen Sie diesen mit Ihren Händen oder einer weichen Decke etc.
- Nicht einengen, nicht festhalten, nichts zwischen die Zähne schieben!
- Patient:in nach dem Anfall in eine stabile Bauch-Seitenlage bringen!
- Die Patient:in ansprechen und nicht alleinlassen, bis sie wieder das Bewusstsein erlangt hat. Evtl. Angehörige bzw. die Rettung verständigen!
Trotz der Erkrankung ist es Betroffenen in den meisten Fällen möglich, ein normales Leben zu führen, in einen normalen Arbeitsprozess eingebunden zu sein und Freundschaften, Liebe und Partnerschaft zu pflegen. Es spricht bei den meisten betroffenen Frauen auch nichts dagegen, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen.
In der Geschichte sind sehr erfolgreiche Menschen bekannt, die an Epilepsie gelitten haben:
- Julius Cäsar,
- Napoleon,
- der Dichter Dostojevski – ein Schriftsteller, der seine Anfälle auch selbst sehr gut in einem Roman von ihm beschrieben hat,
- der Musiker Prince
- oder die Radrennfahrerin und mehrfache Weltmeisterin Marion Clignet.
- Dachverband Epilepsie Österreich (13.08.2018)
- Deutsche Epilepsie-Vereinigung (13.08.2018)
- Antiepileptika (13.08.2018)
- Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs: Epilepsie (03.06.2025)
- Gesundheitsinformation.de: Epilepsie (03.06.2025)
- DocCheck Flexikon: Epilepsie (03.06.2025)
- Deutsche Hirnstiftung: Epilepsie (03.06.2025)
- USZ Universitätsspital Zürich: Epilepsie (03.06.2025)
- Leitlinie S2k: Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter (03.06.2025)