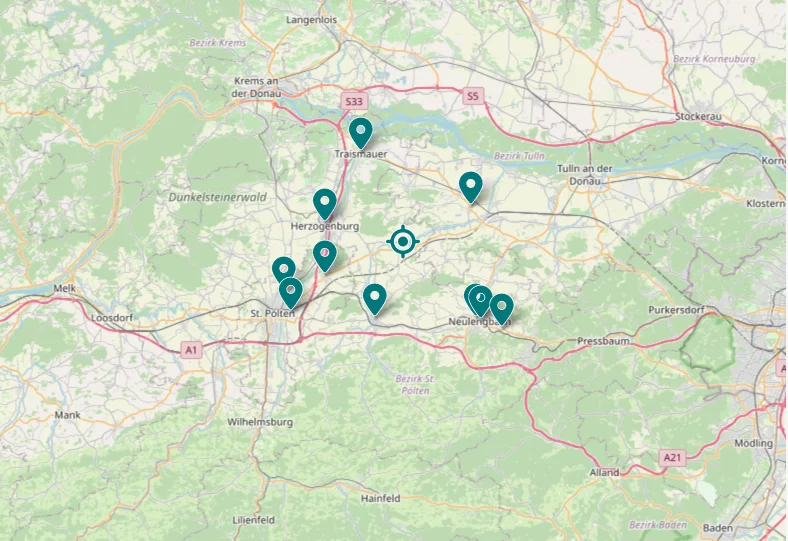Die Infektion ist hoch ansteckend. Dennoch wird Keuchhusten, wie viele andere Infektionserkrankungen fälschlicherweise als "Kinderkrankheit" bezeichnet. Übertragen wird der heimtückische Husten vom Bakterium "Bordetella Pertussis" durch Tröpfcheninfektion. Eine überstandene Infektion schützt nicht vor einem neuerlichen Auftreten der Erkrankung. Da die Erkrankung Spätfolgen haben kann (z.B. Mittelohrentzündung, Asthma, Lungenentzündung) empfehlen Ärzt:innen eine Impfung.
Zusammenfassung
- Keuchhusten ist eine weltweit verbreitete Infektionserkrankung der Atemwege.
- Die Bakterien werden durch Tröpfcheninfektion übertragen.
- Charakteristisch ist der nicht abklingende Husten, der nach ein bis zwei Wochen in bellende, keuchende Hustenanfälle übergeht.
- Wird die Erkrankung frühzeitig erkannt, wird sie mit Antibiotika therapiert.
Keuchhusten im Überblick
| Art | Infektionserkrankung der Atemwege |
|---|---|
| Ursachen | Bakterien gelangen in die Schleimhäute des Rachens und in die Bronchien |
| Symptome | Anfangs unauffällig: Niesen, leichter Schnupfen, Fieber, Heiserkeit, dann bellende keuchende Hustenanfälle |
| Diagnose | Serologische Untersuchung (Antikörper und Lymphozytenstatus), Rachenabstrich, evtl. Röntgenuntersuchung |
| Therapie | Antibiotika |
Österreichweit erkranken jährlich etwa 700 bis 1.000 Menschen an Keuchhusten. 2018 kam es jedoch zu fast 2.200 Fälle. Etwa 20 % der Fälle betreffen Säuglinge, weitere Erkrankungsspitzen haben sich ins spätere Lebensalter verschoben und liegen in den Lebensjahren zwischen 7 und 15, sowie zwischen 60 und 80 Jahren. Weltweit sind etwa 40 Millionen Menschen von Keuchhusten betroffen, etwa 350.000 – vor allem Neugeborene und Säuglinge – sterben im Durchschnitt pro Jahr daran. Am gefährlichsten ist die Krankheit daher vor allem für Säuglinge und Neugeborene.
Die Infektion führt häufig zu:
- fieberhaften Erkankungszuständen
- Mittelohrenentzündung
- gepresster Atmung
- Lungenentzündung
- einer mangelhaften Versorgung von Teilen der Lunge (Atelektase)
Keuchhusten ist zu Beginn hoch ansteckend, die Krankheit verläuft äußerst langwierig, daher bezeichnete man Pertussis früher als "100-Tage-Husten". Nach der Infektion mit Tröpfchen, z.B. durch Husten oder Niesen, gelangen die Bakterien in die Schleimhäute des Rachens und in die Bronchien. Bis die Erkrankung ausbricht, dauert es im Durchschnitt etwa drei bis zwölf Tage.
Die Symptome bleiben anfangs unauffällig und lassen zunächst nicht auf diese Infektionskrankheit schließen:
- Niesen
- trockener Husten
- leichter Schnupfen
- Fieber
- Heiserkeit
Typische Hustenanfälle
Das Charakteristische am Keuchhusten ist jedoch, dass der Husten nicht abklingt, sondern nach diesem erstem, dem "Stadium catarrhale", nach ein bis zwei Wochen in bellende, keuchende Hustenanfälle, das "Stadium convulsivum" übergeht, das sich durch hörbares Einatmen bzw. "Keuchen" charakterisiert. Meist treten diese Attacken nachts auf, das Stadium kann sich über zwei bis vier Wochen erstrecken. Appetitlosigkeit und Niedergeschlagenheit sind weitere Begleiterscheinungen.
Keuchhusten ist schwer zu diagnostizieren. Die Diagnose kann erfolgen durch:
- Erreger ist durch serologische Untersuchung nachweisbar: Dabei können Antikörper sowie ein stark erhöhter Lymphozytenstatus nachgewiesen werden, beides sind deutliche Hinweise auf die Erkrankung.
- Rachenabstrich: Der entnommene Schleim, aber auch Hustenschleim wird auf Vorkommen von Keuchhusten-Bakterien untersucht.
- Röntgenuntersuchung: Kann unter Umständen bei Erwachsenen erforderlich sein. Sie zeigt, ob die Lunge z.B. streifenförmige Flecken aufweist, ein Hinweis auf die Infektion.
Die Erkrankung wird, wenn sie frühzeitig erkannt wird, mit Antibiotika therapiert. Diese Behandlung kann die Schwere der Symptome lindern. Üblicherweise ist der Betroffene etwa 5 bis 6 Wochen ab dem Ausbruch der Erkrankung infektiös. Eine Antibiotikatherapie kann die Ansteckungsgefahr auf 5 Tage ab Therapiebeginn verringern. Spezielle Makrolid-Antibiotika hemmen das Wachstum der Bakterien, haben jedoch keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Die Medikamente sind heute leichter verträglich und ersparen dem Betroffenen Beeinträchtigungen, wie etwa die klassischen Bauchschmerzen.
Die Therapie erfolgt über 14 Tage, doch muss damit gerechnet werden, dass der typische Husten damit nicht verhindert werden kann. Das Bakterium produziert nämlich einen Giftstoff, der die Schleimhaut der Lunge und die Flimmerhärchen angreift. Der Schleim, der abgehustet werden muss, bildet sich nur langsam zurück. Erst wenn die Flimmerhärchen in der Lunge wieder frei sind und sich regeneriert haben, ist mit einer Besserung zu rechnen. Keuchhusten wurde früher auch als "100-Tage-Husten" bezeichnet, erst danach ist eine vollständige Heilung erfolgt.
Antibiotika sind nur dann sinnvoll, solange der Erreger ausgeschieden wird – also zu Beginn der Erkrankung. Kontaktpersonen sollten antibiotisch mitbehandelt werden, wenn sie Keuchhustensymptome bekommen. Hustensäfte sind oft wirkungslos, am ehesten hilft Codein.
Mehr zum Thema: Antibiotika: Wann und wie lange werden sie angewendet?
- Der Betroffen:e sollte isoliert werden, um die Ansteckungsgefahr auf andere zu verhindern.
- Bettruhe und ein gut gelüftetes Zimmer sind Grundvoraussetzungen für die Genesung. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 50 % oder mehr.
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, da der Erkrankt:e viel davon verliert.
- Mahlzeiten nur in kleinen Portionen einnehmen (Hustenanfälle sind häufig von Übelkeit begleitet)
Üblicherweise wird im Zuge des Mutter-Kind-Passes im 3., 5. und 12. Lebensmonat im Zuge der Sechserimpfung (Diptherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus infl. B, Hepatitis B) geimpft, eine Viererimpfung ab dem 7. Lebensjahr (Diphterie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis) frischt den Schutz auf. Er hält bei Kindern etwa 6 bis 9 Jahre an, bei Erwachsenen länger, bei Senioren ab 60 wieder etwas kürzer.
Kombinierte Impfstoffe gibt es auch für Erwachsene. Daher sind entsprechende Auffrischungsimpfungen je nach Alter auch für Erwachsene empfohlen. Vor allem Menschen in Gesundheitsberufen oder Eltern, die ihre Kinder und Babys anstecken könnten, sollten auf einen entsprechenden Impfschutz achten.
Impfkomplikationen gibt es kaum, sie stehen in keiner Relation zu den Vorteilen einer Impfung. Für Babys, Kinder ab 3 Jahren (und Erwachsenen) stehen jeweils spezielle Impfstoffe zur Verfügung. Gegenwärtig werden in Österreich nur mehr "azelluläre" Impfstoffe verwendet, das sind Impfstoffe, die nur Teile eines Erregers erhalten und daher besser verträglich sind.