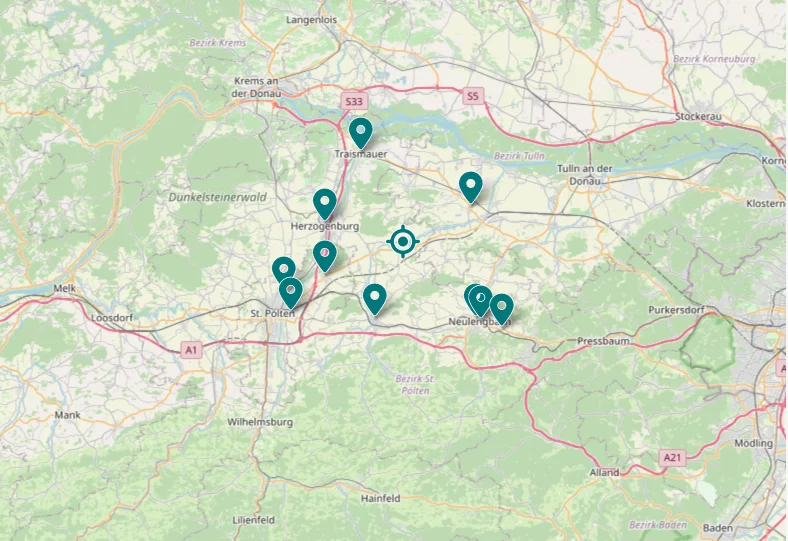Hass und Liebe können sich schnell abwechseln, es kommt verstärkt zu Wutausbrüchen bzw. zu Angst, verlassen zu werden. 1-2% der Bevölkerung sind jährlich von der Persönlichkeitsstörung betroffen, etwa ab dem 30. Lebensjahr stabilisiert sich der Verlauf. Weitere psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen gehen oft mit der Borderline-Störung einher. Bei der Therapie werden meist medikamentöse Therapien mit Psychotherapie kombiniert.
Zusammenfassung
- Eine Borderline-Störung zeichnet sich vor allem durch Probleme bei der Regulierung von Gefühlen und Impulsen aus.
- Durch ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren kann die Persönlichkeitsstörung entstehen.
- Zu den Symptomen zählen Angst vor dem Verlassenwerden, instabile intensive Beziehungen, Identitätsstörung, Impulsivität, Selbstverletzung/Suizid, instabile Gefühlslage, andauerndes Gefühl von Leere, Wut, Aussetzer des Realitätsempfindens.
- Meist wird zur Behandlung eine medikamentöse Therapie gemeinsam mit Psychotherapie eingesetzt.
Borderline-Störung im Überblick
| Art | Persönlichkeitsstörung |
|---|---|
| Ursachen | Zusammenspiel von Faktoren wie Genetische Veranlagung, Traumata, Eltern-Kind-Beziehung |
| Symptome | Angst vor dem Verlassenwerden, instabile intensive Beziehungen, Identitätsstörung, Impulsivität, Selbstverletzung/Suizid, instabile Gefühlslage, andauerndes Gefühl von Leere, Wut, Aussetzer des Realitätsempfindens |
| Diagnose | Anamnese, Selbstbeurteilungsfragebögen, halbstrukturierte Interviews, Fremdbeurteilung |
| Therapie | Psychotherapie, medikamentöse Therapie |
"Borderline" kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Grenzland/Grenzlinie. Der Begriff wurde ursprünglich für diese Persönlichkeitsstörung gewählt, weil von einem "Grenzfall zwischen Neurose und Psychose" ausgegangen wurde.
Jedes Jahr bekommen 1-2% der Menschen die Diagnose Borderline-Störung. Männer und Frauen sind zirka gleich häufig betroffen. In der psychiatrischen Klinik machen Menschen mit Borderline-Störungen etwa 15-25% aller stationären und 10% der ambulanten Patient:innen aus.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung entsteht durch ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren:
| Genetische Veranlagung | Manche Menschen tragen Genvarianten in sich, die das Auftreten der Borderline-Störung wahrscheinlicher machen. Dabei handelt es sich um Gene, die den Botenstoff Serotonin beeinflussen. Studien haben gezeigt, dass der Stoffwechsel dieses Neurotransmitters besonders bei impulsiven und aggressiven Verhaltensweisen gestört ist. Serotonin ist u.a. für die Regulierung der Gefühle zuständig. |
|---|---|
| Traumata | Traumatisierende Erlebnisse wie etwa körperliche oder sexuelle Gewalterfahrungen in der Kindheit können gemeinsam mit der genetischen Veranlagung zum Ausbruch der Persönlichkeitsstörung führen. |
| Eltern-Kind-Beziehung | Wenn Kinder durch ihre Eltern (oder andere Bezugspersonen) abgewertet und ihre Gefühle nicht ernst genommen werden und sie sich nicht geborgen fühlen können, stellt das ebenfalls einen Risikofaktor dar. |
Da biologische und psychosoziale Faktoren bei der Entstehung der Borderline-Störung zusammenwirken, spricht man von einem "biopsychosozialen Krankheitsmodell".
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung zeichnet sich vor allem durch Probleme in der Regulierung der eigenen Gefühle und Impulsivität aus. 5 der folgenden Symptome müssen vorhanden sein, bevor von einer Borderline-Störung gesprochen wird:
- Angst vor dem Verlassenwerden: Betroffene bemühen sich verzweifelt darum, ein tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden (z.B. von der Partner:in) zu vermeiden. Über die Ängste wird oft nicht gesprochen, stattdessen verhalten sich die Betroffenen unangemessen wütend.
- Instabile, intensive Beziehungen: Die Beziehungen von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeit zeichnen sich durch einen Wechsel zwischen Extremen aus: Liebe und Hass wechseln sich ab. Zuerst klammern sich die Betroffenen an die Partner:in, dann stoßen sie sie wieder weg.
- Identitätsstörung: Borderline-Betroffene haben kein gefestigtes Selbstbild mit festgelegten Einstellungen, Meinungen und Wertvorstellungen, sie erleben ihre Identität je nach Gesellschaft unterschiedlich.
- Impulsivität: Die impulsiven Handlungen können dem Betroffen:en Schaden zufügen und treten in zumindest zwei Bereichen auf: z.B. beim Essen (Fressanfälle), beim Geldausgeben, beim Autofahren (rücksichtsloses, risikoreiches Fahren), Drogenmissbrauch, Sexualität (ungeschützter Sex).
- Selbstverletzung und Suizid: Etwa 3/4 aller Borderline-Betroffenen fügen sich selbst Verletzungen zu (z.B. Ritzen oder Schneiden der Haut). Außerdem wird Selbstmord angedeutet oder versucht. Etwa jeder 10. Betroffene begeht Suizid.
- Instabile Gefühlslage: Innerhalb von wenigen Stunden kann die Stimmung von Borderline-Betroffenen stark schwanken. Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Depressionen und Wut sind häufig.
- Andauerndes Gefühl von Leere: Betroffene fühlen sich innerlich leer; sie verlangen von der Partner:in, dass sie ihnen Orientierung gibt – wenn sie alleine sind, haben sie das Gefühl, nicht zu wissen, wer sie sind (passend zur Identitätsstörung).
- Wut: Heftige, unberechenbare Wutausbrüche und Schwierigkeiten, die eigene Wut zu kontrollieren treten bei Betroffenen auf.
- Aussetzer des Realitätsempfindens: Vorübergehend, besonders wenn Belastungen auftreten, können Betroffene psychotische Symptome zeigen. Sie empfinden die Realität nicht mehr so wie sie ist, es können z.B. paranoide Vorstellungen oder Halluzinationen auftreten.
Die Borderline-Störung bricht bei den meisten Menschen im frühen Erwachsenenalter aus. Bis zum 30. Lebensjahr sind die Beeinträchtigungen im alltäglichen Leben am schlimmsten, danach stabilisiert sich der Verlauf meist. Der Verlauf der Borderline-Störung ist besser, wenn:
- weder antisoziales Verhalten in der Kindheit vorliegt
- noch traumatische Erfahrungen in der Kindheit vorliegen
- kein Alkohol- und Drogenmissbrauch betrieben wird
Da es aber zu Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen kommt und Betroffene Schwierigkeiten haben, Ausbildungen zu Ende zu bringen bzw. in ihrem Job zu bleiben, muss die Borderline-Störung behandelt werden.
Bei etwa 10 Prozent der Betroffenen kommt es zu Selbstmord, vor allem, wenn Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholmissbrauch stattfindet. Die Suizidwahrscheinlichkeit erhöht sich durch:
- ein niedrigeres Einkommen
- Selbstmordfälle in der Familie
- kein Zugang zu psychiatrischer Betreuung
Zur Diagnose wird eine ausführliche Anamnese durchgeführt. Zumindest fünf der oben beschriebenen Symptome müssen vorliegen, bevor die Borderline-Störung diagnostiziert wird. Diese werden u.a. abgefragt:
- mit Selbstbeurteilungsfragebögen (wie z.B. dem Borderline-Persönlichkeits-Inventar)
- mit halbstrukturierten Interviews
- durch Fremdbeurteilung
Bei der Diagnose wird auch darauf geachtet, die Borderline-Störung genau von anderen psychischen Störungen abzugrenzen. Oft treten neben der Borderline-Persönlichkeitsstörung auch Depressionen, Essstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen oder Substanzmissbrauch auf.
Mehr zum Thema: Depression » Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Bei der Therapie wird zumeist eine medikamentöse Therapie gemeinsam mit Psychotherapie eingesetzt. Dabei wird besonders auf weitere vorliegende psychische Störungen geachtet und diese werden mitbehandelt.
| Medikamentöse Therapie | Für die medikamentöse Therapie können Psychopharmaka wie Antidepressiva, z.B. selektive Serotonin- Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Neuroleptika oder Medikamente, die Stimmungsschwankungen vermindern, eingesetzt werden. |
|---|---|
| Psychotherapie | Bei der Psychotherapie werden mit speziellen verhaltenstherapeutischen und psychoanalytischen Behandlungsverfahren gute Erfolge erzielt. Im Einzel- oder Gruppensetting lernen die Betroffenen, wie sie ihre eigenen Gefühle, Denk- und Verhaltensmuster besser wahrnehmen und regulieren können. |
Mehr zum Thema: Psychotherapie » Wann kommt sie zum Einsatz?
Für die Angehörigen von Betroffenen gibt es Einrichtungen, die ihnen im Umgang mit der psychischen Störung helfen, wie z.B. HPE Österreich.
- Interview mit Dr. Friedrich Schmidl, Klinischer & Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut
- P. H. Soloff, L. Chiappetta: Prospective Predictors of Suicidal Behavior in Borderline Personality Disorder at 6-Year Follow-Up. In: American Journal of Psychiatry, 2012, 169:5, S. 484-490.
- F. Leichsenring, E. Leibing, J. Kruse, A. S. New, F. Lewek: Borderline personality disorder. In: The Lancet, 2011, 377, S. 74-84.
- Borderline: Diagnostik, Therapie, Forschung. J. G. Gunderson, Verlag Hans Huber, Bern, 2005.