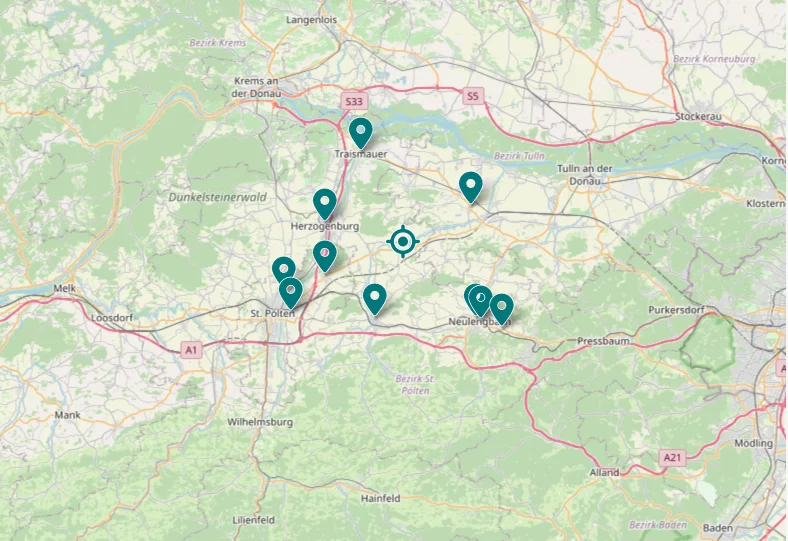KI passt sich dem Nutzerverhalten und den menschlichen Bedürfnissen immer mehr an. Das bedeutet, es werden durch die Nutzung Anreize geschaffen. Belohnung und Bestätigung werden kommuniziert. Dadurch wird unser Belohnungszentrum, in dem Dopamin ausgeschüttet wird, aktiviert. Ist ein gutes Gefühl auf Knopfdruck verfügbar, ist das Risiko groß, eine Abhängigkeit zu entwickeln. In diesem Artikel soll auf die Definition, Symptome, Ursachen, Risiken sowie auf die Behandlung einer KI-Sucht eingegangen werden.
Zusammenfassung
- Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass künstliche Intelligenz durch die zunehmende Nutzung im Alltag mittlerweile sehr präsent ist.
- Dies zeigt sich beim Lernen, bei der Suche nach Informationen, für Intimitäten und auch zur Unterhaltung.
- Immer mehr Menschen kommunizieren mit dem KI-System, nutzen es exzessiv in zahlreichen Lebenslagen und bauen emotionale Beziehungen auf.
- Im Rahmen einer Psychotherapie können Betroffene Verhaltensänderungen und einen sorgfältigen Umgang mit dem Chatbot erlernen.
- Bei der Behandlung soll es zu einer echten Beziehungserfahrung kommen, bei der die Resonanzerfahrung von großer Bedeutung ist.
KI-Abhängigkeit im Überblick
| Art | Suchterkrankung, Verhaltenssucht |
|---|---|
| Ursachen | Einsamkeit, Langeweile, Gewohnheit, soziale Ängste |
| Symptome | Exzessive Nutzung, Kontrollverlust, Craving (Verlangen), Toleranzentwicklung (Zunahme der Verhaltensintensität, also Frequenz und Dauer der Konsumzeit), Vernachlässigung anderer Tätigkeiten (sozial und beruflich), weitermachen trotz negativer Konsequenzen, KI wird vermenschlicht |
| Diagnose | klinisch-psychologische Diagnostik (ICD11: 6C51) |
| Therapie | Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Selbsthilfegruppen |
FAQ (Häufige Fragen)
Wie wirkt sich KI auf die Psyche aus?
Im Rahmen einer Studie gaben Teilnehmer:innen an, sich bei Routineaufgaben und kognitiven Aufgaben stark auf KI zu verlassen. Gefährdet sind dabei vor allem Jugendliche und junge Erwachsene: Eine starke Abhängigkeit zeigte, dass die Entwicklung kritischen Denkens sowie Kreativität negativ beeinflusst werden kann. Grundlegende Denkvorgänge, wie eigenständiges Problemlösen, Informationsanalysen sowie die Bildung fundierter Urteile werden weniger ausgeprägt.
Was macht KI mit uns Menschen?
Fortschrittliche KI-Systeme können Nutzer:innen in einen sogenannten Flow-Zustand versetzen – ein Moment tiefer Konzentration und innerer Ruhe. Besonders für psychisch belastete Menschen kann dies stabilisierend wirken. Moderne Chatbots führen inzwischen menschenähnliche Gespräche. Freundschafts- oder Begleit-Apps reagieren oft empathisch und sozial sensibel – sie erkennen emotionale Signale und vermitteln Verständnis. Viele teilen persönliche Gedanken mit ihrer virtuellen Assistenz. Das schafft Vertrauen – ähnlich wie in menschlichen Beziehungen. Für Betroffene kann dies entlastend sein, etwa bei Einsamkeit oder emotionaler Unsicherheit.
Was wird KI niemals können?
Zu beachten ist, dass der Chatbot seine Nutzer:in zufrieden stimmen will, sie bestätigt und freundlich hilft, jedoch nicht kritisiert.
Bei künstlicher Intelligenz ist eine Maschine dazu in der Lage, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Planen, Lernen und Kreativität zu imitieren. Durch die Verfügbarkeit großer Datenmengen, Fortschritte in der Rechenleistung und neuen Algorithmen konnten in den letzten Jahren bahnbrechende Durchbrüche erzielt werden.
KI ist im Alltag mittlerweile sehr präsent, z.B.:
- Bei der Websuche: Suchmaschinen liefern relevante Suchergebnisse und lernen aus umfangreichen Daten der Nutzer:innen.
- Beim Formulieren von Texten und automatischen Übersetzungen: KI kann Texte zu gewünschten Themen verfassen und als Übersetzungstool für geschriebene und gesprochene Sprache genutzt werden.
- Beim Online-Shopping und Werbung: Kund:innen können personalisierte Empfehlungen gegeben werden, basierend auf früheren Produktsuchen oder sonstiges Online-Verhalten.
- Smart Home: Geräte lassen sich durch Sprachbefehl steuern, wie z.B. "Fahre die Rollos herunter!". Thermostate können z.B. aus unserem Nutzungsverhalten lernen, um Energie zu sparen.
- Als persönlicher Assistent: Der Chatbot kann Fragen beantworten, Empfehlungen abgeben und bei der Organisation des Alltags behilflich sein.
Immer öfters wird von Fällen berichtet, in denen Menschen emotionale Beziehungen zu einer KI aufbauen und ihr hörig werden. Die große Gefahr ist die permanente Verfügbarkeit. Handy und Internet stellen Trigger dar, die Dopamin ausschütten und überall genutzt werden können. So ist der Chatbot jederzeit da, antwortet innerhalb von Sekunden, hört bei Problemen zu und macht vorurteilsfrei Lösungsvorschläge. Außerdem vermittelt die KI den Eindruck, immer eine Antwort oder Lösung zu haben.
Die Nutzung wird wiederholt und dadurch zu einer Gewohnheit und immer selbstverständlicher. Der Austausch und die Bindung zu dem Computer fühlen sich für Betroffene echt an – wie zu einem Menschen. So werden echte zwischenmenschliche Beziehungen durch virtuelle ersetzt. Die künstliche Intelligenz wird vermenschlicht und wie eine gute Freund:in oder romantische Partner:in behandelt. Es entsteht eine Abhängigkeit.
Als wesentliche Ursache für KI-Abhängigkeit wird Einsamkeit gesehen. In einer Studie wird festgehalten, dass sich die Menschen weltweit noch nie so allein gefühlt haben. Als Bewältigungsstrategien nutzen sie KI-Anwendungen, um ihr Wohlbefinden zu steigern.
Zu den Faktoren, die die Entstehung einer KI-Abhängigkeit begünstigen, zählen:
- Einsamkeit
- Dopaminausschüttung
- Permanente Verfügbarkeit
- Digitale Medien (wie Smartphones und Internet) als Trigger
- Soziale Akzeptanz
Fortschrittliche KI-Systeme können Nutzer:innen in einen sogenannten Flow-Zustand versetzen – ein Moment tiefer Konzentration und innerer Ruhe. Besonders für psychisch belastete Menschen kann dies stabilisierend wirken. Moderne Chatbots führen inzwischen menschenähnliche Gespräche. Freundschafts- oder Begleit-Apps reagieren oft empathisch und sozial sensibel – sie erkennen emotionale Signale und vermitteln Verständnis. Viele teilen persönliche Gedanken mit ihrer virtuellen Assistenz. Das schafft Vertrauen – ähnlich wie in menschlichen Beziehungen. Für Betroffene kann dies entlastend sein, etwa bei Einsamkeit oder emotionaler Unsicherheit.
Mehr zum Thema: Einsamkeit » Was tun, wenn man einsam ist?
Ein wichtiges Symptom ist das Craving-Verlangen, also das permanente Daran Denken und der psychische Sog dort hin. Grundsätzlich können die generellen Suchtsymptome laut ICD10 genannt werden, wie:
- Craving,
- Kontrollverlust,
- Toleranzentwicklung,
- Entzug,
- Vernachlässigung,
- und anhaltender Konsum.
Davon müssen nur drei über einen Zeitraum von 12 Monaten gleichzeitig zutreffen.
Besteht ein starkes Abhängigkeitsverhältnis, wird Künstliche Intelligenz exzessiv und in zahlreichen Lebenslagen genutzt. Sie wird z.B. für allgemeine Informationsanfragen, zur Planung von Terminen, kreatives Schreiben, Brainstorming, aber auch in intimen Momenten wie beispielsweise für sexuelle Rollenspiele verwendet. KI nimmt immer mehr Zeit und Raum ein, während andere Tätigkeiten (sozial sowie beruflich) vernachlässigt werden.
Im Rahmen einer Studie gaben Teilnehmer:innen an, sich bei Routineaufgaben und kognitiven Aufgaben stark auf KI zu verlassen. Gefährdet sind dabei vor allem Jugendliche und junge Erwachsene: Eine starke Abhängigkeit bei jüngeren Personen (im Alter von 17-25 Jahren) zeigte, dass die Entwicklung kritischen Denkens sowie Kreativität negativ beeinflusst werden kann. Grundlegende Denkvorgänge, wie eigenständiges Problemlösen, Informationsanalysen sowie die Bildung fundierter Urteile werden weniger ausgeprägt.
Zu beachten ist, dass der Chatbot seine Nutzer:in zufrieden stimmen will, sie bestätigt und freundlich hilft, jedoch nicht kritisiert. KI geht auf jedes Thema ein, auch z.B. auf Verschwörungserzählungen oder Suizid. Der Chatbot fragt immer weiter nach und hält die Konversation aufrecht. Dadurch besteht das Risiko, dass Betroffene noch tiefer in die Thematik hineingezogen werden.
Als ein deutliches Warnzeichen, dass die Nutzung der KI in eine alarmierende Richtung geht, kann es gesehen werden, wenn eine "kognitive-emotionale Dissonanz" (ein Zwiespalt zwischen dem, was man denkt und was man fühlt) bemerkt wird: Der Nutzer:in ist zwar bewusst, dass sie mit einer Maschine kommuniziert, reagiert jedoch emotional, als wäre sie ein Mensch.
Liegt der Verdacht einer Abhängigkeit vor, ist eine Psychotherapeut:in die ideale Ansprechpartner:in. Zur Diagnosestellung bei Abhängigkeiten und Sucht wird die Krankengeschichte der betroffenen Person erhoben. Zudem können weitere Erhebungen sowie Untersuchungen (z.B. klinisch-psychologische Diagnostik oder neurologische Untersuchungen zur Messung des Neurotransmitters Dopamin) nötig sein.
Menschen, die unter KI-Abhängigkeit leiden, können Unterstützung in Form von Psychotherapie in Anspruch nehmen. Durch Verhaltensänderungen und kognitive Verhaltenstherapie, die das Bewusstsein fördert, kann ein sorgfältiger und achtsamer Umgang mit KI-Systemen erlernt werden.
Auch der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen kann bei der Überwindung der Sucht helfen.
Mehr zum Thema: Sucht » Welche Arten von Sucht gibt es?
Da KI über das Potenzial verfügt, menschliche Emotionen zu erkennen und zu beeinflussen, ergibt sich eine neue Facette der Medienkompetenz: sich seiner Menschlichkeit bewusst zu sein. In der Lage zu sein, menschliche Fähigkeiten, Emotionen und Reaktionen zu erkennen und zu verstehen, während man digitale Systeme nutzt. Seitens der Forschung wird betont, dass Bildungsstrategien notwendig sind, um einen kritischen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu fördern.
Um einer KI-Abhängigkeit vorzubeugen, können Präventionsstrategien sinnvoll sein, wie z.B.:
- Bewusstsein schaffen: Aufklärung über potenzielle Risiken durch Schulungen, Seminare
- Mehr Selbstkontrolle: durch individuelle Grenzsetzungen, Zeitlimits und Pausen während der Anwendung
- Zeitmanagement: feste technikfreie Zeit, Konsum schrittweise reduzieren, mehr Zeit für Natur, soziale Aktivitäten, Interessen wieder mehr nachgehen wie Musik, Malen oder Sport
- Verantwortungsvolle Nutzung: Erstellen von Richtlinien zur sorgfältigen Nutzung von KI in Unternehmen, Organisationen
Es gibt eine Chance der Veränderung. Wer sich von der Online-Sucht löst, gewinnt Freiheit, Nähe und Lebensfreude zurück. Digitale Abhängigkeit raubt Zeit und Energie. Jeder Schritt heraus bedeutet mehr Selbstbestimmung und inneren Freiraum. Das Durchbrechen alter Muster stärkt das Selbstbewusstsein und eröffnet neue Perspektiven. Es bleibt mehr Zeit für Beziehungen, Hobbys und persönliche Entwicklung. Ohne ständige Ablenkung entsteht wieder echte Verbundenheit – Nähe, Vertrauen und Interesse am Gegenüber. Weniger Bildschirmzeit bringt mehr Klarheit, Motivation und Zufriedenheit in den Alltag.
- Der Standard: Anonyme KI-Süchtige: Erste Selbsthilfegruppe für Chatbot-Abhängige (11.08.2025)
- Marriott, H. R., & Pitardi, V. (2023). One is the loneliest number. . . Two can be as bad as one. The influence of AI Friendship Apps on users’ well‐being and addiction. Psychology and Marketing, 41(1), 86–101.
- Shank, D. B., Koike, M., & Loughnan, S. (2025). Artificial intimacy: ethical issues of AI romance. Trends in Cognitive Sciences.
- Deutschlandfunk Nova: Forschende warnen vor emotionaler Beziehung zu KI (11.08.2025)
- Deutschlandfunk Nova: Mein Partner, die KI: Wann sich eine Beziehung echt anfühlt (25.08.2025)
- Gerlich, M. (2025). AI Tools in Society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. Societies, 15(1), 6.
- Kurier: Erschreckende Studie: Jugendliche können von KI abhängig werden (11.08.2025)
- Europäisches Parlament: Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken (11.08.2025)
- Europäisches Parlament: Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt? (11.08.2025)
- Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs: Wie wird die Diagnose Internetsucht gestellt? (11.08.2025)
- Schmid-Meier, C. (2023). Künstliche Intelligenz und menschliche Emotionen. Deleted Journal, 29(09), 29–34.