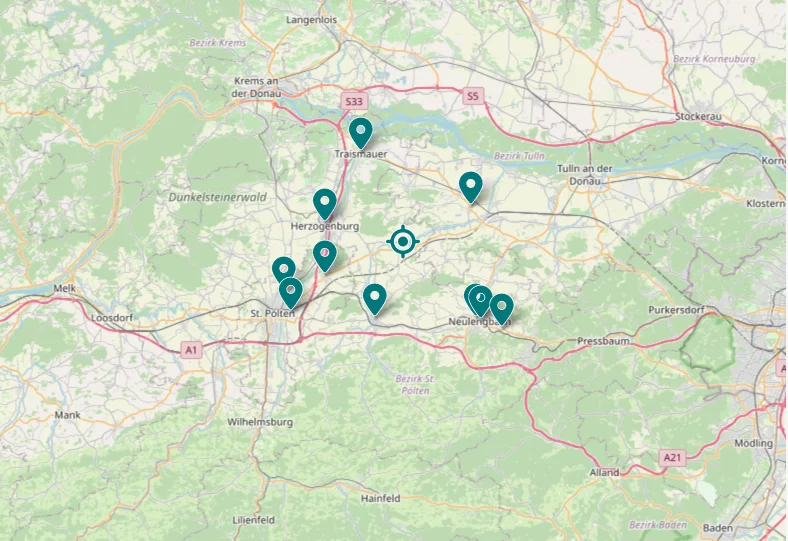Mikroplastik ist überall zu finden und hat Folgen für Umwelt, Tiere und Menschen. Man findet es in Böden, Sedimenten, Pflanzen, Tieren, in der Luft und auch im Meer und es kann auch in die Nahrungskette gelangen.
Zusammenfassung
- Mikroplastik ist überall zu finden.
- Es besteht aus unterschiedlichen Kunststoffarten und ist kleiner als fünf Millimeter.
- Mikroplastik entsteht vor allem durch Reifenabrieb.
- Der Mensch kann Mikro- und Nanoplastik einatmen oder über die Nahrung aufnehmen.
- Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind noch nicht genau geklärt. Hier sind weitere Studien notwendig.
- Die allgemeine Empfehlung lautet aber, die Belastung durch Mikroplastik möglichst gering zu halten.
FAQ (Häufige Fragen)
Wo steckt am meisten Mikroplastik drin?
Es entsteht durch den Abrieb oder Zerfall größerer Plastikprodukte wie z.B. Autoreifen oder Plastikflaschen oder wird direkt in Produkten wie Kosmetika oder Reinigungsmitteln eingesetzt.
Was ist an Mikroplastik so gefährlich?
Mikroplastik wurde schon in vielen menschlichen Organen nachgewiesen. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen sind noch nicht eindeutig geklärt.
Mögliche Risiken bisheriger Forschung:
- Entzündungsreaktionen
- Hormonelle Veränderungen
- Zell- und Organschäden
Wie kann man Mikroplastik aus dem Körper entfernen?
Derzeit gibt es keine belastbaren Studien, die belegen, ob und in welchem Ausmaß der menschliche Körper Mikro- und Nanoplastik abbauen kann.
Mikroplastik sind kleinste Kunststoffpartikel aus unterschiedlichen Kunststoffarten, die kleiner als fünf Millimeter sind. Mikroplastik ist für das bloße Auge kaum zu erkennen. Es entsteht durch den Abrieb oder Zerfall größerer Plastikprodukte wie z.B. Autoreifen oder Plastikflaschen oder wird direkt in Produkten wie Kosmetika oder Reinigungsmitteln eingesetzt.
Man unterscheidet zwei Arten:
- Primäres Mikroplastik: Wird gezielt hergestellt, z.B. für Kosmetika oder Reinigungsmittel.
- Sekundäres Mikroplastik: Entsteht unbeabsichtigt durch den Zerfall größerer Kunststoffteile, z.B. durch Reifenabrieb, Plastikmüll oder beim Waschen synthetischer Kleidung. Nach heutigem Wissensstand besteht das in der Umwelt vorgefundene Mikroplastik zum überwiegenden Teil aus sekundärem Mikroplastik.
Bei Kunststoffpartikeln im Nanometerbereich (1 bis 1000 nm) spricht man von Nanoplastik. Nanoplastik wird entweder gezielt als Nanopartikel in bestimmten Produkten eingesetzt oder entsteht durch den Abbau von größeren Plastikteilchen.
Mikroplastik ist nahezu überall zu finden. Es gelangt über verschiedene Wege in die Umwelt und anschließend in den menschlichen Körper und wurde bereits im Blut, in der Plazenta und im Gehirn nachgewiesen.
Mögliche Ursachen:
| Reifenabrieb: | Dem Österreichischen Umweltbundesamt zufolge trägt Reifenabrieb am meisten zur Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt bei. |
|---|---|
| Kleidung: | Kunstfasern wie Polyester oder Acryl setzen durch die Reibung beim Waschen Mikroplastik frei. |
| Drogerieprodukte: | Shampoo, Nagellack und Co. enthalten oft Mikroplastik. Dieses gelangt über den Abfluss ins Abwasser. |
| Plastikmüll: | Verpackungsmaterialen und PET-Flaschen landen in der Natur und zersetzen sich dort zu Mikroplastik. |
Diese Partikel verteilen sich über Wasser, Luft und Boden in die gesamte Umwelt.
Menschen nehmen Mikroplastik vor allem über die Luft und Nahrung auf. Das bedeutet, dass die feinen Partikel eingeatmet oder über den Magen-Darm-Trakt in den Körper gelangen.
Ein Beispiel: Kläranlagen können Mikroplastik nur begrenzt herausfiltern, wodurch es in Flüsse, Seen und Meere gelangt. Fische nehmen das Mikroplastik mit der Nahrung auf, wird der Fisch anschließend verzehrt, können die feinen Partikel so auch in den menschlichen Organismus gelangen.
Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen sind noch nicht eindeutig geklärt.
Mögliche Risiken bisheriger Forschung:
- Entzündungsreaktionen
- Hormonelle Veränderungen
- Zell- und Organschäden
Mikroplastik wurde schon in vielen menschlichen Organen nachgewiesen. Bereits 2021 konnten in einer Studie der MedUni Wien gemeinsam mit der TU Graz erstmals Mikroplastik-Partikel im Fruchtwasser von Schwangeren nachgewiesen werden. Eine weitere Studie der MedUni Wien (2023) im Tiermodell zeigt, dass Mikroplastik die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Diese ist eine wichtige zelluläre Barriere, die das Gehirn vor dem Eindringen von Krankheitserregern oder toxischen Stoffen schützen soll. Eine Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den Menschen ist derzeit jedoch nicht eindeutig gesichert.
Beobachtungen zeigen zudem, dass Mikro- und Nanoplastik bösartige Veränderungen in Lungenzellen auslösen können, die mit der Entstehung von Krebs in Verbindung stehen (MedUni Wien 2025). Auch erhöht Mikro- bzw. Nanoplastik das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle durch Entzündungsreaktionen in den Blutgefäßen (New England Journal of Medicine, 2024).
Die Erforschung ist komplex: Mikroplastik ist kein einheitlicher Stoff, sondern ein Mix verschiedener Kunststoffe und Zusatzstoffe. Für eine aussagekräftige Risikobewertung braucht es Fakten. So muss genau geklärt sein, welcher Stoff in welcher Konzentration über welchen Zeitraum wie aufgenommen wurde und zu welchen Folgen das geführt hat. Solche Untersuchungen sind für Mikro- und Nanoplastik sehr schwer durchführbar. Auch die Größe der Plastikpartikel spielt eine Rolle, denn davon hängt es ab, ob sie vom Körper aufgenommen werden oder nicht: Je kleiner die Plastikteilchen sind, desto tiefer können sie in den Organismus eindringen.
An den gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen, wird intensiv geforscht.
Mikroplastik wurde schon in vielen menschlichen Organen nachgewiesen. Bereits 2021 konnten in einer Studie der MedUni Wien gemeinsam mit der TU Graz erstmals Mikroplastik-Partikel im Fruchtwasser von Schwangeren nachgewiesen werden.
Derzeit gibt es keine belastbaren Studien, die belegen, ob und in welchem Ausmaß der menschliche Körper Mikro- und Nanoplastik abbauen kann. Die potenzielle Umwandlung von Mikroplastik in Nanoplastik im Verdauungssystem ist ein weiterer, bislang kaum erforschter Aspekt.
Trotz der undeutlichen Studienlage empfehlen Expert:innen die Belastung durch Mikroplastik so gering wie möglich zu halten. Das können Sie tun:
- Gestalten Sie Ihren Einkauf möglichst plastikfrei.
- Trinken Sie Leitungswasser statt Wasser aus Plastikflaschen.
- Bei Kosmetikprodukten auf Mikroplastik achten. Mithilfe von bestimmten Apps ist es möglich, kritische Inhaltsstoffe in Produkten und Lebensmitteln zu erkennen.
- Vermeiden Sie Einwegplastik und nutzen Sie wiederverwendbare Trinkflaschen, Einkaufssackerln und Co.
- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Kunststoffprodukte richtig.
- Bei Kleidung auf natürliche Materialien wie Baumwolle oder Leinen achten. Finger weg von synthetischen Materialien wie Polyester.
- Beim Wäschewaschen spezielle Wäschesäckchen verwenden, die Mikrofasern auffangen und so verhindern, dass diese ins Abwasser gelangen.
Mehr zum Thema: Klimwandel » Auswirkungen auf Gesundheit & Psyche
- Greenpeace: Mikroplastik – Gefahr für Mensch & Umwelt (23.07.2025)
- Medizinische Universität Wien: Winzige Plastikpartikel gelangen auch ins Gehirn (23.07.2025)
- Medizinische Universität Wien: Mikro- und Nanoplastik im Körper wird bei Zellteilung weitergegeben (23.07.2025)
- AGES: Mikroplastik (23.07.2025)
- Bundesinstitut für Risikobewertung: Mikroplastik: Fakten, Forschung und offene Fragen (23.07.2025)
- Quarks.de: Wie gefährlich ist Mikroplastik (23.07.2025)
- Pharmazeutische Zeitung: Plastik in Plaques erhöht Herzinfarktrisiko drastisch (19.08.2025)
- Schmidt R, Nachtnebel M, Dienstleder M, Mertschnigg S, Schroettner H, Zankel A, Poteser M, Hutter H-P, Eppel W, Fitzek H (2021): Correlative SEM-Raman microscopy to reveal nanoplastics in complex environments. Micron 144:103034.
- MedUni Wien: Mikroplastik kann bösartige Veränderungen in Lungenzellen auslösen (11.08.2025)