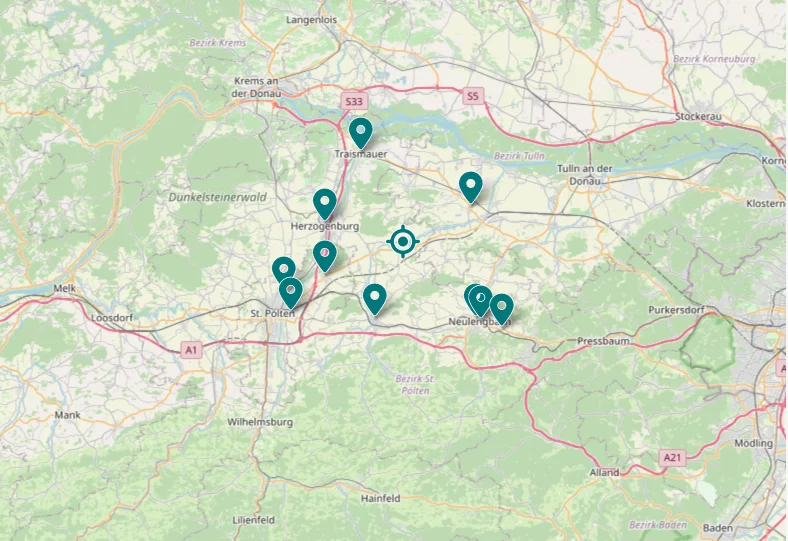Die Erde erwärmt sich schneller als erwartet. In Österreich stieg die Temperatur in den letzten 150 Jahren um durchschnittlich +2 Grad Celsius. Die WHO weist darauf hin, dass die extremen Wetterbedingungen, die der globale Klimawandel langfristig mit sich bringt, eine Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen darstellt. Sie belasten das Herz-Kreislauf-System, können u.a. zu Atemwegserkrankungen, Infektionen oder Allergien führen. Auch auf die mentale Gesundheit hat die Klimakrise Auswirkungen. Immer mehr Menschen sind von negativen Gedanken und Emotionen, Angstzuständen oder Depressionen betroffen.
Zusammenfassung
- Die Klimaerwärmung bringt große Herausforderungen für die Gesundheit der Menschen mit sich.
- Bedingt durch Hitze- und Kälteperioden und damit verbundener Umweltverschmutzung, kontaminiertem oder mangelndem Trinkwasser bis hin zu Zoonosen, kann es zu körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen kommen.
- Durch die schnellen Umweltveränderungen ist das Immunsystem überfordert und somit anfälliger für Infektionen und Krankheiten.
- Die Entwicklungen des Klimas und der Umwelt führen bei immer mehr Menschen zu Zukunftsängsten.
- Es bedarf Maßnahmen für den Klimaschutz zu treffen, die in Zukunft noch verstärkt werden sollten.
FAQ (Häufige Fragen)
Was ist der Grund für den Klimawandel?
Treibende Kraft des Klimawandels ist der Treibhauseffekt. Vor allem durch den menschengemachten Treibhauseffekt wird dieser Effekt verstärkt, da die Konzentration einiger Treibhausgase durch menschliche Aktivitäten (wie Verbrennung fossiler Brennstoffe, Abholzung von Wäldern, Viehzucht) stark angestiegen ist.
Was für Folgen hat der Klimawandel?
Die WHO weist darauf hin, dass die extremen Wetterbedingungen, die der globale Klimawandel langfristig mit sich bringt, eine Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen darstellt. Sie belasten das Herz-Kreislauf-System, können u.a. zu Atemwegserkrankungen, Infektionen oder Allergien führen. Auch auf die mentale Gesundheit hat die Klimakrise Auswirkungen, immer mehr Menschen sind von negativen Gedanken und Emotionen, Angstzuständen oder Depressionen betroffen.
Wen trifft der Klimawandel am stärksten?
Als besonders vulnerabel gelten folgende Personengruppen:
- Säuglinge, Kleinkinder und Kinder
- Schwangere
- Geschwächte und ältere Personen ab 65 Jahren
- Personen mit chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege oder mit Diabetes, Asthma oder Krebs
- Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen oder Pflegebedarf
- Übergewichtige Menschen
- Obdachlose oder sozial isolierte Menschen
- Menschen, die im Freien arbeiten
- Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Menschen, die sich ungesund ernähren und/oder einen Mikronährstoffmangel aufweisen
Treibende Kraft des Klimawandels ist der sogenannte Treibhauseffekt:
Energiereiche kurzwellige Strahlung gelangt von der Sonne in die Atmosphäre und trifft auf die Erde ein. Dabei wird ein Teil dieser Strahlung von Wolken, Aerosolen und Treibhausgasen bereits absorbiert. Der andere Teil erreicht die Erdoberfläche und wird von Wasser, Gesteinen, Böden, Grasflächen sowie von Asphaltflächen aufgenommen, in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt und anschließend wieder an die Atmosphäre und den Weltraum abgegeben.
Dieser Vorgang wird durch den Treibhauseffekt jedoch erschwert: Treibhausgase absorbieren und streuen einen Teil der langwelligen Strahlung, so dass diese auf die Erdoberfläche zurückfällt. Erdoberfläche sowie die untersten Luftschichten werden dadurch erwärmt.
Durch den menschengemachten Treibhauseffekt wird dieser Effekt verstärkt, da die Konzentration einiger Treibhausgase durch menschliche Aktivitäten (wie Verbrennung fossiler Brennstoffe, Abholzung von Wäldern, Viehzucht) stark angestiegen ist. Dies gilt besonders für:
- Kohlendioxid (CO2)
- Methan (CH4)
- Distickstoffoxid
- Fluorierte Gase
Extrem heiße Tage oder extreme Niederschläge wirken sich direkt und indirekt auf den menschlichen Organismus aus. Durch die Zunahme der Luftschadstoffe steigt das Risiko für Atemwegserkrankungen und Allergien und Erkrankungen infolge überlasteter Entgiftungskapazitäten des Körpers. Durch hohe Temperaturen können in Trinkwasser und Gewässern vermehrt Krankheitserreger auftreten, auch Lebensmittel können kontaminiert werden. Zudem ist das Immunsystem stärkerer Beanspruchung ausgesetzt.
Als besonders vulnerabel gelten folgende Personengruppen:
- Säuglinge, Kleinkinder und Kinder
- Schwangere
- Geschwächte und ältere Personen ab 65 Jahren
- Personen mit chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege oder mit Diabetes, Asthma oder Krebs
- Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen oder Pflegebedarf
- Übergewichtige Menschen
- Obdachlose oder sozial isolierte Menschen
- Menschen, die im Freien arbeiten
- Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Menschen, die sich ungesund ernähren und/oder einen Mikronährstoffmangel aufweisen
Die Anzahl der Hitzewellen und Hitzetagen wird weiterhin zunehmen. Die hohen Temperaturen, die damit einhergehen, belasten den menschlichen Organismus mitunter enorm. Das Herz-Kreislauf-System wird durch die Hitze stark belastet.
Zu den körperlichen Hitzefolgen zählen u.a.
- Schwächegefühl
- Schwindel
- Benommenheit
- Verwirrtheit
- Ohnmacht
- Müdigkeit, Erschöpfung
- Übelkeit, Erbrechen
- geringere körperliche Leistungsfähigkeit
- Hitzekrämpfe
- Herzinfarkt, Schlaganfall
- Kreislaufversagen, Hitzeschlag
Abkühlung und eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und Elektrolyten sind während heißer Tage und Tropennächte wichtig. Durch das vermehrte Schwitzen, verliert der Körper Flüssigkeit und Salz. Vorsicht ist vor allem bei älteren Menschen geboten, da ihr Durstgefühl im Alter abnimmt. Durch die Schwäche steigt auch die Sturzgefahr.
Mehr zum Thema: Flüssigkeitszufuhr » Heute schon genug getrunken?
Auch Kälte stellt eine starke Belastung für das Herz-Kreislauf-System dar und ist ein oft unterschätztes Risiko. Statistisch betrachtet war Kälte in den vergangenen Jahren sogar tödlicher als Hitze: Im Rahmen einer Studie wurden zwischen 1991 und 2020 in Europa in der Mitte rund 364.000 Kältetote gegenüber rund 44.000 Hitzetoten verzeichnet.
Während der kalten Jahreszeit breiten sich Viren und Bakterien schneller aus und die Immunabwehr ist geschwächt. Die Anfälligkeit für Infekte (u.a. Influenza, COVID-19) und Atemwegserkrankungen, wie etwa Lungenentzündungen, steigt. Hinzu kommt der vermehrte Konsum von Alkohol oder Drogen.
Allgemeine Maßnahmen während Kälteperioden:
- Hygienemaßnahmen wie Händewaschen oder das Tragen einer Maske, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen
- Höhere Versorgung vor allem älterer, vorerkrankter Personen oder Personen mit erhöhtem Bedarf ( Schwangere, Sportler:innen etc.) mit Mikronährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen, Omega Fettsäuren etc.
- Schutzimpfungen (z.B. Grippe, Pneumokokken)
- Obdachlosen Menschen helfen, bei Bedarf Kältetelefon anrufen
Luftverschmutzung und Pilzinfektionen
Sandstürme, Waldbrände oder eine hohe Luftfeuchtigkeit während Hitzeperioden begünstigt u.a. die Entstehung von Pilzsporen in der Luft und im Boden und führt zu einer allgemeinen Verschlechterung der Luftqualität, vermehrten Pilzinfektionen (Mykose) und auch Schimmelbildung.
Pollen und Allergien
Vermutlich ist auch mit einer höheren Pollenbelastung zu rechnen, wodurch Allergien, allergische Reaktionen, Asthma und andere Atemwegserkrankungen zunehmen. Expert:innen rechnen im Zuge des Klimawandels auch damit, dass sich wärmeliebende, bisher nicht heimische allergene Pflanzen- und Tierarten ausbreiten könnten.
Verschmutzungen und Verunreinigungen
Ernteausfälle und große Dürren, Überschwemmungen und extreme Temperaturschwankungen führen zu Lebensmittelknappheit, verunreinigten Lebensmitteln und Wasserknappheit bzw. auch verunreinigtem Trink- und Grundwasser. Dies führt zu Unter- und Mangelernährung sowie zur Ausbreitung von Krankheitserregern.
Infektionskrankheiten
Die schnellen Veränderungen der Umwelt führen dazu, dass sich der Organismus und das Immunsystem nicht schnell genug anpassen können, wodurch es überfordert und anfälliger für Infektionen und Krankheiten ist. Aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen kommt es vermehrt zu Zoonosen (Erkrankungen, die von Tier auf Mensch übertragen werden) und einer Ausbreitung exotischer Insekten, Zecken, Mücken und Schädlinge. Der Umgang mit gebietsfremden Krankheitserregern stellt das Immunsystem und die Medizin vor neue Herausforderungen. Die Asiatische Tigermücke gilt beispielsweise als Erreger für das Denguefieber und das West-Nil-Virus.
Temperaturen über 30 Grad Celsius lösen Schwankungen des Serotoninspiegels aus, wodurch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen ausgelöst oder verstärkt werden können. Wissenschaftliche Analysen machen deutlich, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Hitze und Suizidalität besteht.
Doch nicht nur wetterbedingte Veränderungen, auch indirekte Einflüsse, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen, haben Einfluss auf die psychische Verfassung und Verhaltensänderungen, wie etwa:
- die Arbeitssituation,
- Armut oder Krankheiten,
- gesellschaftliche Konflikte,
- Hoffnungslosigkeit,
- Migration
- oder Nahrungsmittelunsicherheit.
Auch nehmen Missbrauch, häusliche Gewalt sowie der Alkohol- und Drogenmissbrauch zu, insbesondere nach Extremwetterereignissen. Daten belegen, dass ein Jahr nach Überschwemmungen bei einem Viertel der Betroffenen Angsterkrankungen und einem Fünftel unter Depressionen auftreten.
Folgende Auswirkungen auf die Psyche können Veränderungen des Klimasystems u.a. haben:
- Angst
- Lethargie
- Frustration
- Teilnahmslosigkeit
- gedrückte Stimmung
- geringere geistige Leistungsfähigkeit
- Aggressivität
- Schizophrenie
- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- Posttraumatische Belastungsstörungen
- Suizide
Immer mehr überwiegend junge Menschen entwickeln eine sogenannte "Klimaangst". Die Zunahme von Naturkatastrophen, deren Intensität und die Auswirkungen (u.a. Nahrungsmittelknappheit, Migration), aber auch die oft fehlende Unterstützung der Politik, machen der jungen Bevölkerung immer mehr zu schaffen.
Der Gedanke an die Zukunft bereitet zunehmend Sorge, wodurch als Reaktion darauf wiederum Angststörungen und Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit ausgelöst werden können. Dies wirkt sich direkt auf den Alltag und wichtige Lebensentscheidungen wie die Wahl von Ausbildung und Beruf oder den Kinderwunsch aus. So möchten immer mehr Junge aus Angst vor den klimatischen Veränderungen und den Folgen, die diese mit sich bringen, keine Kinder mehr in die Welt setzen.
Im Zusammenhang mit den klimatischen Veränderungen und Auswirkungen wurden bereits auch neue Begriffe geprägt:
- Solastalgie: Das Gefühl des Verlustes und der Trauer, wenn sich Naturräume, die eigene Heimat oder der gewohnte Lebensraum durch Umweltzerstörung verändert hat oder dieser sogar verlassen werden musste. Der Aufenthalt in der Natur, speziell im Wald hat nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf den Körper positive Auswirkungen. Dabei spielen nicht nur Luftqualität, sondern auch die Inhalation von verschiedenen natürlichen Aromen und ätherischen Ölen eine positive Rolle.
- Auch die Veränderung von Lebensumständen und Zukunftsperspektiven fällt darunter.
- Eco-anxiety, Eco-distress, Climate anxiety bzw. Klimaangst, Öko-Angst: Die Furcht vor Umweltkatastrophen, die die eigene Zukunft oder die der nachfolgenden Generation betreffen. Damit gehen Wut, Angst, Trauer und Hoffnungslosigkeit einher.
Forscher:innen und Expert:innen rechnen bis 2050 mit vermehrten Hitzeperioden, Gletscherschmelze, starker Trockenheit und Dürre, aber auch vermehrtem Starkregen, Fluten und Überschwemmungen. Die kommenden Jahrzehnte beeinflussen das Tempo und die Intensität des Klimawandels. Expert:innen betonen: Es bedarf ökologisch verantwortungsbewusstes Handeln.
Beispiele für Klimaschutzmaßnahmen:
- Mobilität: Umweltfreundliche Fortbewegungsmittel wie öffentliche Verkehrsmittel, Zug oder Rad wählen und kurze Distanzen zu Fuß gehen, Fahrgemeinschaften nutzen.
- Ernährung: Auf klimafreundliche Ernährung setzen und regionale und saisonale Produkte wählen sowie den Fleischkonsum reduzieren.
- Politik: Die Politik ist angehalten, den Klimaschutz ernst zu nehmen. Das bedeutet beispielsweise eine weltweite Reduktion der Treibhausgase, das Nutzen klimafreundlicher Technologien, eine klimafreundliche Stadt- und Raumplanung (mehr Grünflächen, keine Bodenversiegelung) für eine bessere Lebensqualität.
- Verringerung der Plastikflut, Mikroplastik, Windräder (Carbon)
Österreich verfolgt das Ziel, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein.
Mehr zum Thema: Radfahren » Die richtige Ausrüstung
- Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: Klimaresilienz des Gesundheitssystems: Österreich begegnet dem Klimawandel (13.12.2024)
- Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs: Gesundheit und Klimawandel (13.12.2024)
- Medizinische Universität Wien: Hitze kann psychische Erkrankungen auslösen oder verstärken (13.12.2024)
- Springer Medizin: Klima und Psyche eng verschränkt (13.12.2024)
- Stadt Wien: Wiener Hitzeaktionsplan. Gesundheitliche Auswirkungen der Hitze (13.12.2024)
- Thieme: Klimawandel, Gesundheitskompetenz und psychische Gesundheit (13.12.2024)
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: Studien zur gesundheitlichen Anpassung an die Folgen des Klimawandels (13.12.2024)
- Frontiers in Science: Immune-mediated disease caused by climate chang-associated environmental hazards: mitigation and adaption
- Neurologen und Psychiater im Netz: Der Klimawandel beeinflusst auch die Psyche (13.12.2024)
- The Lancet Public Health: Temperature-related mortality burden and projected change in 1368 European regions: a modelling study (13.12.2024)
- World Health Organization: Climate change (13.12.2024)
- Education21 – Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE): Treibhauseffekt (25.03.2025)
- Umweltbundesamt: Klima und Treibhauseffekt (25.03.2025)
- Europäische Kommission – Energie, Klimawandel, Umwelt: Ursachen des Klimawandels (25.03.2025)