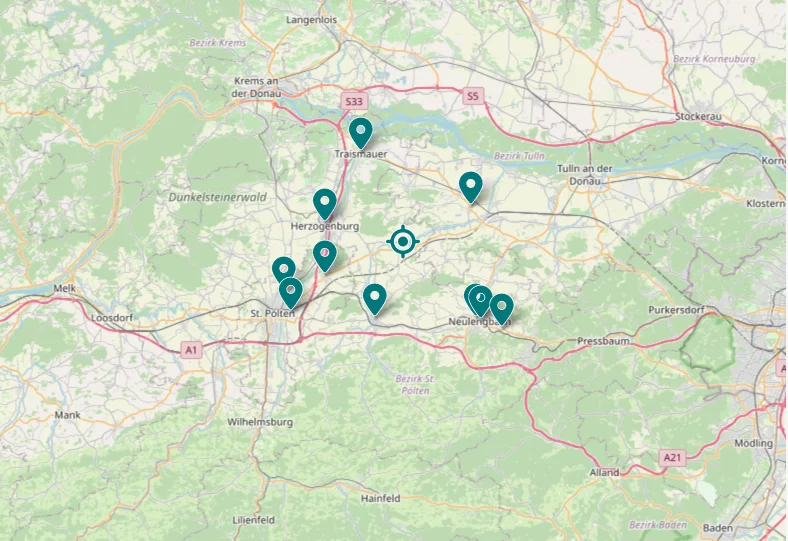Die Mukoviszidose, auch Cystische Fibrose genannt, ist eine Erbkrankheit. Bei Betroffenen sind Wasser- und Salzhaushalt gestört, infolgedessen verklebt zähes Sekret die Bronchien, die Gänge der Galle, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Es kommt zu wiederkehrenden Entzündungen und die Organe können nicht mehr richtig arbeiten. Die Erkrankung ist bis heute nicht heilbar, doch an spezialisierten Ambulanzen inzwischen gut behandelbar. Dementsprechend ist die Lebenserwartung von Betroffenen in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen.
Zusammenfassung
- Mukoviszidose ist eine vererbte Stoffwechselkrankheit.
- Die Ursache der Erkrankung liegt in einem gestörten Wasser- und Salzhaushalt. Zähes Sekret verklebt in der Folge die Bronchien, die Gänge der Galle, der Bauchspeicheldrüse und der Leber.
- Zu den Symptomen zählen unter anderem hartnäckiger Husten mit Schleim, Lungeninfektionen, Lungenentzündung, Bronchiektasen, Kurzatmigkeit, Keuchen und Verdauungsstörungen.
- Bei der Behandlung wird versucht, den zähen Schleim in den Atemwegen zu lockern und die Bakterien zu bekämpfen. Auch der Verdauungstrakt wird mit Pankreas-Enzymen und gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel therapiert.
Mukoviszidose im Überblick
| Art | Stoffwechselerkrankung |
|---|---|
| Ursachen | Gestörter Wasser- und Salzhaushalt |
| Symptome | Hartnäckiger Husten mit Schleim, Lungeninfektionen, Lungenentzündung, Bronchiektasen, Kurzatmigkeit, Keuchen, evtl. Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen, verminderter Gewichtszunahme |
| Diagnose | Neugeborenenscreening, Bestimmung des immunreaktiven Trypsins, bei Verdacht Analyse der Chloridkonzentration im Schweiß, evtl. genetische Untersuchung zur Bestimmung der Mutation |
| Therapie | Inhalationen mit bronchienerweiternden und schleimverflüssigenden Medikamenten, Antibiotika, Pankreas-Enzyme, evtl. Nahrungsergänzungsmittel, CFTR-Modulatoren, bei bereits weit fortgeschrittener Krankheit: Lungentransplantation |
Die Mukoviszidose betrifft in Österreich etwa 25 Neugeborene pro Jahr und ist damit hierzulande die häufigste Erbkrankheit. Mukoviszidose ist nicht ansteckend. Zirka 5 % der Gesamtbevölkerung sind Träger eines entsprechend defekten Gens, die meisten erkranken selbst aber nicht daran. Tragen beide Elternteile den Gendefekt in sich, besteht für das Kind ein Erkrankungsrisiko von etwa 25 %.
Die Ursache der Erkrankung liegt in der Mutation eines bestimmten Gens, welches das Protein CFTR ausbildet. Dieses an Zelloberflächen festsitzende Protein (ein Chloridkanal) reguliert den Salz- und Wassertransport in der Membran von Epithelzellen (Zellen der oberste Schicht des Haut- und Schleimhautgewebes) und hat somit direkte Auswirkungen auf viele Organe.
Von Person zu Person sind die Krankheitszeichen unterschiedlich ausgeprägt. Auch der Verlauf der Krankheit lässt sich nicht sicher vorhersagen. Viele Kinder entwickeln bereits im ersten Lebensjahr Auffälligkeiten, manche aber auch erst im Jugend- oder Erwachsenenalter.
Typische Symptome sind häufige Erkrankungen der Atemwege:
- Hartnäckiger Husten mit dickem Schleim
- Lungeninfektionen (durch verschiedene Bakterien)
- Bronchiektasen (Schädigung der Atemwege, bei der diese ausgeweitet werden)
- Lungenentzündung
- Kurzatmigkeit
- Keuchen
- Ungewöhnlich salziger Schweiß
- Schlappheit durch Salzverlust
- Häufige Entzündungen der Nase und Nasennebenhöhlen
- Gallensteine, erhöhte Leberwerte, Schrumpfleber (Leberzirrhose)
Außerdem leiden Betroffene oft an Verdauungsstörungen mit Durchfällen, fettigem Stuhl, Bauchschmerzen und verminderter Gewichtszunahme. Langfristig können sich – von Patient:in zu Patient:in unterschiedliche – weitere Krankheiten entwickeln. Hervorzustreichen sind hier insbesondere Diabetes und Osteoporose.
Diabetes
Der sogenannte CFRD (Cystic Fibrosis-Related Diabetes) wird auch als Typ-3c-Diabetes klassifiziert. Er hängt insbesondere mit den bei der Cystischen Fibrose auftretenden Beeinträchtigungen der Bauchspeicheldrüse zusammen. Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle. So erhöht jene Genmutation, die eine Mukoviszidose verursacht, auch die Wahrscheinlichkeit eines Diabetes. Darüber hinaus stehen für die Erkrankung typische Medikamente sowie ein Mangel an Vitamin D im Verdacht, das Risiko auf die Zuckerkrankheit zu erhöhen.
Diagnosestellung: Die Diagnose gestaltet sich oft schwierig, da sich die Symptomatik mit jener der cystischen Fibrose zum Teil überschneidet. So ist es etwa im Falle einer Gewichtsabnahme nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob diese im Rahmen der Grunderkrankung auftritt oder durch einen neu entwickelten Diabetes verursacht wurde. Dementsprechend werden Menschen mit Mukoviszidose jährliche Screenings empfohlen, um eine etwaige Zuckerkrankheit dennoch frühzeitig zu erkennen.
Einfluss des Körpergewichts: Ein wesentlicher Unterschied des CFRD zu Diabetes Typ 1 und Typ 2 ist der Einfluss des Körpergewichts. Während starkes Übergewicht der größte Risikofaktor für einen Typ-2-Diabetes ist, ist es bei Betroffenen der Cystischen Fibrose genau umgekehrt. Je niedriger der Body Mass Index (BMI) ist, umso höher ist das Diabetesrisiko. Trotz bereits diagnostiziertem CFRD wird den Patient:innen geraten, eine energie- und fettreiche Ernährung einzuhalten.
Osteoporose
Die Knochensubstanz geht im Laufe des Lebens zurück, dabei handelt es sich um einen natürlichen Prozess. Bei Menschen mit Osteoporose geht dieser Prozess krankhaft beschleunigt vonstatten.
Betroffene von chronischen Lungenerkrankungen sind statistisch gesehen öfter von Osteoporose betroffen. Bei der cystischen Fibrose ist das entsprechende Risiko sogar schon im Teenager-Alter erhöht. Zu diesem Zusammenhang tragen mehrere Faktoren bei:
| Entzündungen | Chronische Lungenerkrankungen bedingen Entzündungen, unter denen der gesamte Körper leidet und wodurch sich auch andere Beschwerden bemerkbar machen können. |
|---|---|
| Hypoxämie | Eine mangelnde Sauerstoffversorgung im Rahmen einer Lungenerkrankung beeinträchtigt naturgemäß auch den Sauerstofftransport im Blut. Diese Unterversorgung begünstigt strukturelle Veränderungen des Knochens. |
| Bewegungsmangel | Sport stellt für Betroffene von Lungenerkrankungen eine besondere körperliche und seelische Herausforderung dar. Dass viele daher auf Bewegung weitgehend verzichten, wirkt sich wiederum negativ auf die Knochengesundheit aus. Erschwerend kommen psychische Probleme hinzu, die bei vielen Betroffenen auftreten und das Desinteresse an körperlicher Betätigung zusätzlich verstärken. Eine Rolle dabei spielt auch das sogenannte "vulnerable child syndrome" (in etwa "verwundbares Kind-Syndrom"). Diese bezeichnet die Tendenz vieler Eltern erkrankter Kinder, diesen nicht zu viel zumuten zu wollen. Im Falle der Cystischen Fibrose fördern Eltern so in manchen Fällen indirekt den Bewegungsmangel des Betroffenen. |
| Mangelernährung | Bei vielen Mukoviszidose-Betroffenen kommt es zu einer Mangelernährung, was unter anderem auf den hohen Nahrungsbedarf des Körpers zurückzuführen ist. Außerdem können Nebenwirkungen von Medikamenten und Appetitlosigkeit aufgrund chronischer Infektionen eine Rolle spielen. |
| Vitamin-D- und Vitamin-K-Mangel |
Ein Mangel an Vitamin D ist Studien zufolge bei Betroffenen der Mukoviszidose besonders weit verbreitet. Dieser wirkt sich wiederum negativ auf die Knochensubstanz aus. Außerdem hat der Körper Schwierigkeiten, Nährstoffe aus der Nahrung richtig aufzunehmen, wodurch es auch zu einem Vitamin-K-Mangel kommen kann. Dieser ist wiederum für die Knochensubstanz schädlich und sollte mit Nahrungsergänzungsmittel ausgeglichen werden. |
| Medikamente | Bestimmte Medikamente, die bei Lungenkrankheiten häufig zum Einsatz kommen, können bei dauerhafter Einnahme der Knochensubstanz schaden. |
| Verzögerte Pubertätsentwicklung | Von einer Pubertas tarda sprechen Mediziner:innen, wenn die ersten Anzeichen einer Pubertät im zu erwarteten Alter ausbleiben. |
Kinder mit Cystischer Fibrose, die eine normale Lungenfunktion und einen guten nutritiven Status haben, zeigen hingegen eine normale Knochensubstanz auf. Ein indirekter Faktor in diesem Zusammenhang ist aber auch die gestiegene Lebenserwartung. Dank der medizinischen Fortschritte werden Menschen mit Cystischer Fibrose im Schnitt wesentlich älter als noch vor einigen Jahrzehnten. Diese positive Entwicklung führt naturgemäß zum häufigeren parallelen Auftreten altersbedingter Erkrankungen.
Früherkennung: Die Früherkennung spielt bei der Behandlung eine wesentliche Rolle. Die Knochensubstanz von Mukoviszidose-Betroffenen sollte daher bereits im Alter von 8 bis 10 Jahren erstmals untersucht werden. Zeigen sich im Rahmen dieser Basis-Untersuchung auffällige Werte, sollte die Knochendichtemessung in 2 bis 4 Jahren wiederholt werden. Andernfalls ist eine neuerliche Untersuchung nach spätestens 5 Jahren anzuraten.
Maßnahmen zur Behandlung:
- Bewegung: Entgegenwirken lässt sich der Osteoporose unter anderem mit einem entsprechenden Bewegungsprogramm. Internationalen Leitlinien zufolge sollte es dreimal wöchentlich Bewegungseinheiten von etwa 30 bis 45 Minuten geben. Gewichtstragende Aktivitäten, also etwa Hüpfen, wirken sich besonders positiv aus.
- Ernährungsberatung: Prinzipiell sollte bei Betroffenen der Mukoviszidose eine regelmäßige Ernährungsberatung angedacht werden, um den BMI im Normalbereich zu halten. In Bezug auf die Knochen ist insbesondere auf eine ausreichende Calciumzufuhr zu achten, hierbei bieten sich vor allem Milch bzw. Milchprodukte an. Auch auf eine ausreichende Vitamin-K-Zufuhr sollte man achten. Soweit möglich sollte darüber hinaus der Vitamin-D-Spiegel mit Aktivitäten im Freien angeregt werden.
- Nahrungsergänzungsmittel: Um Mängel entgegenzuwirken, können Kinder gegebenenfalls und in Absprache mit der behandelnden Ärzt:in auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.
- Bisphosphonate: Sollten diese Maßnahmen nicht greifen, stehen als letzte Möglichkeit noch sogenannte Bisphosphonate zur Verfügung, die den Knochenabbau vermindern und so das Knochenbruchrisiko senken. Inwiefern sich die erst seit recht kurzer Zeit angewandten CFTR-Modulatoren auf die Knochengesundheit auswirken, ist nach aktuellem Forschungsstand noch unklar.
Mehr zum Thema: Osteoporose » Wenn die Knochensubstanz beschleunigt zurückgeht...
Cystische Fibrose blieb in der Vergangenheit häufig unerkannt, da die Symptome ähnlich sind wie jene bei:
Neugeborenenscreening: In Österreich werden alle Neugeborenen im Rahmen des Neugeborenenscreenings auf die Erkrankung hin untersucht. Dabei erfolgt zunächst eine Bestimmung des immunreaktiven Trypsins (ein Verdauungsenzym) aus dem Blut. Die Ärzt:in entnimmt dem Neugeborenen dafür üblicherweise Blut aus der Ferse.
Schweißtest: Bei Verdacht auf Cystische Fibrose wird in einer CF-Ambulanz – beim sogenannten Schweißtest – die Chloridkonzentration im Schweiß analysiert. Dabei regt ein Medikament, das in der Regel auf den Unterarm aufgetragen wird, die Schweißbildung an und der übermäßige Salzgehalt kann zuverlässig festgestellt werden.
Genetische Untersuchung: Zur Diagnosebestätigung oder bei unklaren Fällen wird eine genetische Untersuchung zur genauen Bestimmung der Mutation veranlasst. Auf dem verantwortlichen Gen gibt es unterschiedliche Veränderungen, die zu unterschiedlich starken Beschwerden führen. Hierbei anzumerken ist, dass die neuartige Therapie mittels CFTR-Modulatoren spezifisch für bestimmte Mutationen zugelassen ist, somit bestimmt die Mutation zum Teil die Möglichkeiten der Therapien.
Um die Diagnose Cystische Fibrose stellen zu können, muss Folgendes zutreffen:
| ein diagnostischer Hinweis vorhanden sein |
|
| und eine CFTR-Funktionsstörung nachgewiesen sein |
|
Heilbar ist Mukoviszidose bislang leider nicht. Durch verschiedene Behandlungen können Beschwerden jedoch gelindert bzw. hinausgezögert werden. Wichtig ist ein früher Behandlungsbeginn, um die körperliche Entwicklung und die Lebensqualität zu verbessern.
Inhalationen, Antibiotika: Regelmäßige Inhalationen mit bronchienerweiternden und schleimverflüssigenden Medikamenten (Mukolytika) und Atemübungen zählen zur Standardbehandlung. Ergänzend können bei Bedarf Antibiotika eingesetzt werden. Ziel der Behandlung ist es, den zähen Schleim in den Atemwegen zu lockern und die Bakterien zu bekämpfen.
Pankreas-Enzyme: Zur Behandlung des Verdauungstrakts werden Medikamente (Enzyme der Bauchspeicheldrüse) eingesetzt. Sie werden zu jeder Mahlzeit individuell dosiert (Dosis richtet sich nach der Fettmenge) und helfen beim Verdauen.
CFTR-Modulation: Es gibt inzwischen die Möglichkeit einer mutationsspezifischen Therapie. Dabei werden Betroffene mit speziellen Medikamenten – sogenannten CFTR-Modulatoren – gezielt behandelt. Ziel ist es, die Funktion des defekten bzw. fehlenden CFTR-Proteins zu verbessern oder sogar wiederherzustellen. Dadurch können Veränderungen in den Körperzellen teilweise ausgeglichen und die Symptome eingedämmt werden.
- Der Arzneistoff Ivacaftor interagiert mit dem CFTR-Protein. Dadurch wird die Chloridsekretion bei G551D- und anderen Klasse-III-Defekten gesteigert.
- Lumacaftor und Tezacaftor werden in Kombination mit Ivacaftor eingesetzt und können die defekte Proteinsynthese bei F508del-Mutation partiell überwinden und die Dichte an der Zellmembran erhöhen.
- Eine Verbesserung der Lungenfunktion konnte unter der Dreierkombination aus Elexacaftor, Tezacaftor und Ivacaftor nachgewiesen werden.
Die Wirkstoffe werden in Abhängigkeit von den persönlichen genetischen Befunden und dem Alter der Patient:innen zugelassen. In Studien werden weitere Wirkstoffe geprüft.
Lungentransplantation: Die letzte Maßnahme, um Betroffenen bei bereits fortgeschrittener Krankheit ein längeres und auch lebenswerteres Leben zu verschaffen, ist eine Lungentransplantation. Ob und wann dieser Schritt notwendig ist, muss immer in genauer Absprache mit der behandelnden Ärzt:in entschieden werden.
Folgende Dinge sollten Betroffene beachten:
| Ernährung | Ein großer Fokus sollte auf die Ernährung gelegt werden, da sich ein guter Ernährungszustand positiv auf den Verlauf der Krankheit auswirkt. Betroffenen wird oft eine Ernährung mit besonders vielen Vitaminen, Mineralstoffen und Energie empfohlen. Durch neue Therapieoptionen ergeben sich aber mittlerweile unterschiedliche Energiebedarfe – von der klassischen hochkalorischen Ernährung bis zu einer angepassten energieärmeren Ernährungsweise. Im Idealfall wird mit der behandelnden Ärzt:in ein möglichst genauer Ernährungsplan erarbeitet. |
|---|---|
| Schutz vor Infekten | Infektionserkrankungen sind für Menschen mit Mukoviszidose eine größere Herausforderung als für andere Personen. Umso wichtiger ist es, insbesondere im Winter, genau auf die alltägliche Hygiene zu achten. Auch Schutzimpfungen sind, sofern gut verträglich, für diese Gruppe besonders wichtig. |
| Soziale Isolation vermeiden | Die Cystische Fibrose fordert den Menschen auf vielen Ebenen, gerade auch in psychischer Hinsicht. Um trotz etwaiger eingeschränkter Bewegungsfreiheit nicht in die soziale Isolation zu verfallen, ist vor allem das Umfeld gefordert. |
| Bewegung | Mukoviszidose verleitet dazu, auf körperliche Anstrengung fast gänzlich zu verzichten. Regelmäßige Bewegung, seien es Ausdauer- oder Kraftübungen, wirkt sich aber nachweislich positiv auf den Krankheitsverlauf aus. Wichtig ist es bei Mukoviszidose, schon früh mit dem Sport zu beginnen. Mit einer Physiotherapeut:in können passende Übungen erlernt werden. |
Mehr zum Thema: Physiotherapie » Wann kommt sie zum Einsatz?
Früher galt die Mukoviszidose aufgrund der niedrigen Lebenserwartung als reine Kinderkrankheit. Dank immer besserer Therapiemöglichkeiten hat sich dieses Bild mittlerweile deutlich gebessert.
Die Frühdiagnose ist besonders wichtig. Bei zeitgerecht einsetzender Behandlung können heute mehr als 80 % der Betroffenen das Erwachsenenalter erreichen. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines mit Mukoviszidose geborenen Kindes liegt in Deutschland derzeit bei knapp 60 Jahren.
- "Cystische Fibrose", Magazin "Hausarzt", Ausgabe 03/2018
- "Mukoviszidose. Diabetes ist häufiger Begleiter", Pharmazeutische Zeitung, 2014. (06.12.2021)
- "Diabetes mellitus bei Mukoviszidose", Mukoviszidose e.V. Bundesverband Cystische Fibrose (CF). (06.12.2021)
- Cystische Fibrose Hilfe Österreich (Zugriff am 16.07.2024)
- Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung: Mukoviszidose – Was Eltern darüber wissen sollten (16.07.2024)
- Mukoviszidose e.V. (16.07.2024)
- 2-Konsensus-Leitlinie „Diagnose der Mukoviszidose“ (AWMF 026-023), Version 2023
- S3-Leitlinie Mukoviszidose bei Kindern in den ersten beiden Lebensjahren, Diagnostik und Therapie, Version 2020